|
Einführung
| Patrizier | Hessen
| Pfalz | Amerika |
Weltweit |
Wappen | Kontakt
| 
Patrizier im Mittelalter
Die Hartrad
von Dieburg
Die Linie der Hartrad zum Laderam in Frankfurt
Die
Linie des Frankfurter Bürgermeisters Erwin Hartrad
Kleriker
der Diözese Mainz
Die Marburger Hartrad
Die Rothenburger Hartrad
Der
Kartäuserprior Michael Hartrad
Schon im Spätmittelalter
treten in Frankfurt, Marburg und Rothenburg patrizische Familien
Hartrad ins Licht der Geschichte. Ein Zusammenhang dieser
Geschlechter mit unserer aus Friedberg stammenden Wetterauer Familie
ist bislang nicht belegt, aber durchaus denkbar. Besonders zwischen Frankfurt,
Friedberg und Marburg bestanden im Mittelalter enge politische und
wirtschaftliche Verbindungen: so gehörten Friedberg und Frankfurt
seit 1285 gemeinsam dem Wetterauer Städtebund an, ihre Messen waren
terminlich aufeinander abgestimmt. Frankfurt strahlte dank seiner
Messe ohnehin auf den gesamten hessischen und rhein-mainischen Raum
aus, sodass sich zwischen den Bürgern der dortigen Städte häufig
auch familiäre Kontakte ergaben. Viele Geschlechter aus dem
Frankfurter Handelsbürgertum hatten Niederlassungen und
Familienzweige an mehreren Orten, trieben Geschäfte mit dortigen
Angehörigen oder stammten selbst aus der Wetterauer Umgebung.


Blick auf Dieburg, 1743 (Stich von Barthélemy de
LaRocque) | große
Ansicht
Die
Hartrad von Dieburg
Die Geschichte
der südhessischen Hartrad reicht - ganz knapp - bis in staufische
Zeit zurück, also an die Schwelle vom Hoch- zum Spätmittelalter. Zunächst finden
wir unseren Namen hier am südlichen Rand des alten Königsforstes
Dreieich, in Dieburg, am Eingang zum Odenwald, mit einer
Ratsherrenfamilie, die sich nach wenigen Generationen ins
nahegelegene Frankfurt verzweigte und dort ins städtische Patriziat
aufstieg.
Eine
Verwandtschaft dieser Dieburger Familie mit den Friedberger Hartrad
ist keineswegs notwendig und wäre urkundlich auch kaum noch
belegbar. Hypothetisch könnten Mitglieder der Dieburger Hartrad als Dienstmannen der 1255
ausgestorbenen Reichsministerialen von Münzenberg oder ihrer Erben,
der Herren von Falkenstein aus dem Hause Bolanden und der Herren von
Hanau, in die Wetterau gelangt sein: die Münzenberg nämlich
besaßen neben ihrer namensgebenden wetterauischen Herrschaft, die
sie in der Mitte des 12. Jahrhunderts erworben hatten, auch Güter
um ihren Stammsitz, die Burg Hagen (Hayn) im Wildbann Dreieich,
darunter Babenhausen und Münster nahe Dieburg sowie seit 1229 bzw.
1239 auch Dieburg selbst; über die Dreieich waren sie seit dem Ende
des 11. Jahrhunderts als Reichsvögte eingesetzt. Die Hanauer, die
1255 ein Sechstel des Münzenberger Erbes erhielten – unter
anderem Anteile an Münzenberg, 1304 auch an Münster –, hatten
zuvor schon durch Heirat das Amt Babenhausen erworben; in der
Wetterau übten sie 1275-1279, 1300-1305/6 und wieder seit 1349 das
Landvogteirecht aus, und 1275-1279 amtierte Reinhard I. von Hanau
als Burggraf von Friedberg. Die Bolanden wiederum waren seit der
Mitte des 12. Jahrhunderts, also noch vor den Münzenberg, Herren in
Dieburg gewesen, seit 1215 in der Linie Bolanden-Falkenstein;
andererseits waren sie 1255 zu 5/6 Nachfolger der Münzenberg
dortselbst sowie in Münster, dazu später ebenfalls Landvögte in
der Wetterau und Vögte in der Dreieich.
Die Hartrad als
Erbpächter der Mühle Kistelberg
Bereits um die Jahreswende 1253 / 1254,
wenige Monate vor dem Ende der Stauferherrschaft in Deutschland, tritt in Dieburg ein Schöffe
Hartrat als Zeuge auf, als Ulrich von Münzenberg seinem Vogt Rudolf Beckenhube die Mühle Kistelberg bei Münster verleiht (Böhmer/Lau I Nr. 175 / Steiner Nr. 66, vgl. S. 41 und 43). In einer denselben Vorgang betreffenden Urkunde vom 25. März 1254 findet sich unter den Zeugen neben dem schon erwähnten Hartrat noch ein
Heinrich Hartradis (vgl. Erler, S. 123f. / Fichard: Geschlechtergeschichte), der wohl als ein Sohn des Schöffen Hartrat anzusprechen ist. Da die Familie von diesem ihren Namen führt, ist er der älteste fassbare Angehörige des Geschlechts; hinter das Jahr 1254 (oder 1253) geht also kaum ein Weg zurück.
Im übrigen ist die Stadt Dieburg selbst eine Gründung des
ausgehenden 12. Jahrhunderts, und auch die Familien des Ortsadels
sind wenig älter als die Hartrad: so sind die Groschlag und die
Ulner im Jahr 1236, die Drunkel ebenfalls 1254 erstmals bezeugt.

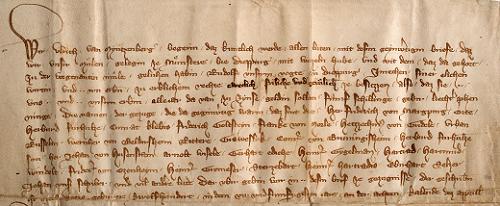
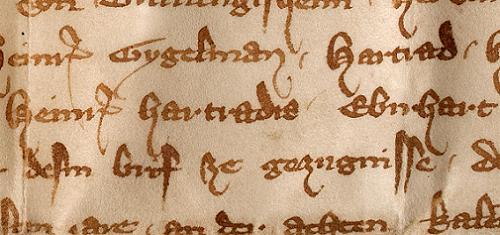
Urkunde
vom 25. März 1254, Abschrift des 14. Jahrhunderts (Staatsarchiv
Darmstadt), Gesamtansicht und Detail. Gegen Ende der neunten Zeile
findet sich unter den Zeugen der Dieburger Schöffe Hartrad, schräg
links darunter in der zehnten Zeile ein Hein(ricu)s Hartradis. Es
handelt sich um den frühesten Beleg des Familiennamens Hartrad
überhaupt.
Urkunde
in großer Ansicht | Detail
in großer Ansicht

Vermutlich ein Sohn
des Heinrich Hartradis ist der 1293 erstmals genannte Dieburger
Schöffe Friedrich Hartrad („Fridericus Hartradi“, vgl. Fichard:
Geschlechtergeschichte); im Jahr 1295 bezeugt
er zusammen mit den übrigen Schöffen der Stadt, dass der
Pfarrer Johannes von Roßdorf seinen Anteil an der Mühle Kistelberg
den Deutschherren in Frankfurt-Sachsenhausen veräußert habe (Baur Nr. 211).
Vorausgegangen
waren diesem Rechtsgeschäft langjährige Auseinandersetzungen
zwischen den Dieburger Familien Groschlag und Aumann einerseits und
einer aus vier Stämmen bestehenden Erbengemeinschaft um Friedrich Ocalp,
Heinrich Lule, den Roßdorfer Priester Johannes und den
Deutschordensbruder Eberhard von Hüttengesäß andererseits, die einander
widerstreitende Ansprüche auf Anteile an dem Mühlenlehen erhoben.
Dem Deutschordenshaus gelang es nach und nach, die verstreuten
Anteile an der Mühle aufzukaufen - unter anderem vom
Frankfurter Bartholomäusstift und den Dieburger Minoriten - und die Groschlag und Aumann zum Verzicht auf ihre
Ansprüche zu bewegen (Aumann, S. 13f. / Niedermayer, S. 120f. / Schrod, S. 107-110 / Seiler S. 302f. /
ausführlich Möller / vgl. die Urkunden die Mühle Kistelberg betreffend bei Steiner Nr.
66-78 sowie bei Schmidt 1972, S. 252-254 und S. 259-261).
Mit dem Roßdorfer Anteil war die Mühle schließlich
ganz in der Hand des Deutschen Ordens und wurde im darauffolgenden
Jahr, 1296, dem Friedrich Hartrad und seiner Frau Lukard („Friderico
dicto Hartdrat et uxori sue Lucen“) in Erbpacht gegeben (Böhmer/Lau
I Nr. 703, Steiner Nr. 79). Als Zins
lieferten die Eheleute jährlich 40 Malter Winterweizen (Roggen), 20
Malter Sommerweizen, einen halben Malter Mehl, vier Lämmer und 13
Pfund Heller, zahlbar je zur Hälfte am Michaels- und am
Walpurgistag. Dieser verhältnismäßig hohe Pachtzins bezog sich
allerdings nicht auf die Mühle allein, sondern auch auf andere
Güter der Deutschherren in Dieburg, welche Friedrich und Lukard
Hartrad aus ihrem eigenen Besitz noch weiter vermehrten: Schon 1296
vermachten sie dem Orden zur Pietanz eine halbe Hufe Landes, von der die Sachsenhausener Kommende 7½ Morgen beim Tod des
einen, weitere 7½ Morgen beim Tod des anderen Ehegatten erhalten
sollte; 1314 verkauften beide dem Orden eine Erbrente von 6 Pfund
Heller jährlich auf ihren Dieburger Liegenschaften (Böhmer/Lau I Nr.
968, Steiner Nr. 81); 1316
schließlich veräußern sie um einen Preis von 35 Pfund Heller
ihren eigenen Hofplatz samt Gebäuden neben der Mühle Kistelberg,
dazu die Besserung der Mühle und ihres Zubehörs (Böhmer/Lau II
Nr. 54, Steiner Nr. 82), was darauf
schließen lässt, dass Friedrich und Lukard in der Zwischenzeit
wertsteigernde Bau- und Instandsetzungsarbeiten an dem gepachteten
Anwesen hatten durchführen lassen.


Die
ehemalige Mühle Kistelberg (später Frühweinsche Mühle oder
Langsmühle) heute
In der Urkunde
von 1316 finden wir auch einen Sohn Rutzo (= Rudolf), der 1334 als Rulmann Hartrad testierte und in letzterem Jahr ebenfalls das
Schöffenamt in Dieburg bekleidete (Baur Nr. 543). 1325 wurde der Mühle die noch
von den Münzenberg an die Vorbesitzer verliehene Schatzungsfreiheit
bestätigt. Nach Beständnisbriefen aus dem Jahr 1326 (Steiner Nr.
84) sowie dem
Frühjahr 1329 (Böhmer/Lau II Nr. 345, Steiner Nr. 85) hatte 1326 ein weiterer „son
etswenne Frideriches genant Hartrad“ (1329), Heilmann
(Heinrich) Hartrad, mit seiner Frau Gerhus auf dem Steinweg die
Mühle Kistelberg für zunächst drei Jahre und dann ohne Befristung
in Erbpacht übernommen, wofür sie dem Deutschen
Orden jährlich 45 Malter Korn, ein Fasnachtshuhn und fünf Pfund
Heller Zins entrichteten. Das Mühlgut umfasste (zu einem mir nicht bekannten Datum) 89 Morgen Ackerland,
13 Mannsmahd Wiesen sowie einen „Hof im Monefeld, genannt der
Hubhof mit mehreren Gärten vor der Stadt, die der Erbpächter
bewohnte“ (Mönfeld war wie Holzhausen/Steinweg und Altenstadt
einer der alten Vororte Dieburgs). 1329 wird der Umfang der zur
Mühle gehörenden landwirtschaftlichen Güter, der sich ausweislich
der fälligen Abgaben offenbar seit 1296 etwas verringert hatte, mit
71 Morgen Ackerland und 15 Mannsmahd Wiesen angegeben, „mit der
schirnen gelegen in der stad“. Als Sicherheit setzte Heilmann 1329
eine
ihm schon gehörende, „Kymen gud“ genannte Viertelhube in
Dieburg mit 17½ Morgen Äckern und 1½ Mannsmahd Wiesen; darüber
hinaus bürgten für ihn mit eigenen Besitzungen sein Schwager
Heilmann „of dem Steynwege“ (ein Mitschöffe Rulmanns 1334)
sowie Culmann
(Konrad) Hartrad, wohl ein weiterer Bruder, und zwar Heilmann
mit einer Dreiviertelhube zu 39½ Morgen Feldern und 5½ Mannsmahd
Wiesen, Culmann mit einer Viertelhube zu 13 Morgen Feldern und zwei
Mannsmahd Wiesen. Nachdem die Mühle den Eltern Friedrich und Lukard
auf beider Lebenszeit vergeben war, wird nicht nur Friedrich,
sondern auch seine Frau 1326 bereits verstorben gewesen
sein. Dafür spricht außerdem, dass Culmann Hartrad für 1325 als
Dieburger Schöffe bezeugt ist (vgl. Fichard: Geschlechtergeschichte); sofern nicht Vater und Sohn
gemeinsam auf der Schöffenbank saßen, sondern das Amt (wie damals üblich) innerhalb der Familie weitergegeben wurde, wäre
das Todesjahr Friedrichs somit schon 1325 oder früher anzusetzen.
Während wir von
Culmann Hartrad in der Folgezeit noch des öfteren hören (s.u.), brechen
die urkundlichen Mitteilungen über seinen Bruder Heilmann 1329 ab. Die Mühle Kistelberg war wohl schon 1374 nicht mehr im Besitz der Hartrad, da in diesem Jahr ein Henne,
Gerlach Hofemanns Sohn, von den Sachenhausener Deutschherren die
Mühle samt Zubehör pachtet, ausgenommen die Schirn in der Stadt (Hessisches Staatsarchiv Darmstadt Best. A 1 Nr.
40/41, vgl. Schmidt 1972, S. 266). 1399 geht das gesamte Mühlgut,
das zuvor Henchin Hoffmann innegehabt hatte, an Henne von Ortenberg
(HStAD Best. A 1 Nr. 40/45, vgl. Schmidt 1972, S. 268). Die Mühle, die noch 1729 als Münstermühle vorkommt
(HStAD Best. A 1 Nr. 40/137), später Frühweinsche Mühle (Schmidt
1977, S. 78) und schließlich Langsmühle heißt, beherbergt heute das Heimatmuseum von Münster.
In den Umkreis der Dieburger Hartrad ist ferner vielleicht der kurmainzische Keller
Hartrad von Dieburg zu zählen, dessen Kellereirechnung für das Jahr 1326/27 fragmentarisch erhalten ist („Nota computationem Hartrardi cellerarii in
Dippurg“, Mersiowsky, S. 101);
1344 rechnet er über den Bau eines Turmes an der erzbischöflichen Burg ab („de edificiis castri nostri in Diepurg in turris f[ac]tis“), da er den Turm aus den laufenden Einnahmen finanziert hatte und dem Erzbischof noch einen Restbetrag schuldig
war (Vogt, S.
58 Anm. 4 / Grathoff,
S. 74 / Struck, S. 166). Dieburg gehörte seit Anfang
des 14. Jahrhunderts vollständig zum Mainzer Hochstift, das hier
schon im 13. Jahrhundert Rechte erworben hatte. Im Unterschied zum
Vogt, der meist dem Niederadel angehörte, stammte der Keller, der
für den Ortsherren die Finanzverwaltung zu besorgen hatte, oft aus
dem Bürgertum des jeweiligen Amtsortes. In diesem Fall ist aber
nicht sicher zu sagen, ob ‚Hartrad‘ als Vor- oder Zuname
gebraucht wird.
vgl.
zur mittelalterlichen Geschichte Dieburgs: Johann Wilhelm Christian
Steiner: Altertümer und Geschichte des Bachgaus im alten Maingau,
3. Teil (Geschichte der Stadt Dieburg...), Darmstadt 1829 


Ansicht Frankfurts am Main von Südwesten, aus Matthäus Merians
Topographia Hassiae et Regionum Vicinarum, 1655 | große
Ansicht

Die Linie der
Hartrad zum Laderam in Frankfurt
Culmann
Hartrad
von Dieburg („Culman Hartrade“) erscheint 1331 in Dieburg als
Anrainer eines Grundstücks „nebn der Kesesbrucken an der stillen Erden“
(Jost, S. 305). In den 1330er- und 1340er-Jahren begegnen wir ihm
dann gemeinsam
mit seiner Frau Hilde oder Hille Hartrad (= „Hille Kolman“, „Hille
Culmann“, „Frawe Hille von Dyp[ur]g“ ) wiederholt als Käufer
verschiedener Gülten in der Dieburger Gegend: 1335 gab Ritter
Hermann Aumann dem „Culman Hartdrade“ und „Hillen sin elichen
frauwen“ auf acht Jahre 25 Malter Korn- und zehn Malter
Weizengülte zu Reinheim (südlich von Dieburg an der Bergstraße),
die er von Graf Wilhelm von Katzenellenbogen innehatte (Baur Nr.
544); 1340
erhielten die beiden eine Pfenniggülte von 7 Pfund Heller zu
Sickenhofen und eine von 1 Pfund Heller zu Hergershausen (heute zwei
Ortsteile von Babenhausen) von Oswald, Johann und Hermann Groschlag,
die Sickenhofen und Hergershausen als hanauische Lehen besaßen
(Baur Nr. 565),
schließlich 1345 eine Gülte zu „Ziegelhard“ (= Zeilhard, heute
zu Reinheim) vom Ritter Hartmann von Zwingenberg (Steiner Nr. 86).
Die Familie scheint in jenen Jahren
bereits nähere Beziehungen nach Frankfurt unterhalten zu haben. Schon 1301 trägt ein
Flurstück bei Bockenheim den Namen Hartradisbuzs (Böhmer/Lau
I Nr. 787), der natürlich nicht zwingend vom Familiennamen „Hartrad“
herstammen muss, sondern ebensogut von einem Personennamen
abgeleitet sein kann. 1317 wird in Frankfurt der
Weinschröter Heilo Hartrad
(„Heilo Hartradus sartor vini“) erwähnt (Böhmer/Lau II Nr. 81,
Anm. 58), bei dem es sich
vielleicht um Culmanns Bruder, den Mühlenpächter Heilmann Hartrad
handelt (wobei der Beruf des Weinschröters nicht so recht zur sozialen Stellung der Dieburger Hartrad passen mag). Die Schröter waren für die Verladung der zu Schiff
ankommenden Weinfässer und den Transport in die Keller der
Stadthäuser zuständig; an der Schiffsanlegestelle vor St.
Leonhard, wo die Fracht mit Kränen an Land gesetzt wurde, entstand
der Weinmarkt. Die Hartrad hatten, zumindest später,
Immobilien in diesem Bereich der Stadt, nämlich in den Jahren 1354
bzw. 1366 ein oder zwei Häuser am Kornmarkt, seit etwa 1369 das
dortige Haus zum Heiligenstein, seit mindestens 1387 das ebenfalls
hier gelegene Haus zum dürren Baum sowie seit 1398 das Haus
Altenburg (Aldenburg, Alteburg) gegenüber der Leonhardskirche.


Ruine der Burg Hayn in der Dreieich, wo Culmann Hartrad 1357 Schultheiß war. Stahlstich von Christian
Haldenwang, um 1800.

1341 wird ein [N.N.] Hartrad von Dieburg in den Frankfurter Schöffenprotokollen erwähnt (Fichard: Geschlechtergeschichte); vielleicht ist dies Culmann, wie Friederichs (1969, S. 16) meint, vielleicht auch einer seiner Brüder. 1353
amtiert Culmann als Schultheiß Ulrichs III. von Hanau in Hayn
(Dreieichenhain; vgl. Fichard). 1357 ist er wohl verstorben, vielleicht an der
Pest, die 1349 und 1357 die Frankfurter Gegend heimsuchte; denn am 17. August 1357 erlangte
Culmanns Frau Hille für sich selbst das Bürgerrecht der Stadt Frankfurt und
wurde, nachdem sie geschworen hatte, als „Hylle Hartraden von
Dypurg“ ins Bürgerbuch eingetragen (Andernacht/Stamm, S. 64). Möglicherweise ist dies ein
Hinweis darauf, dass Culmann mit seiner Familie schon früher einmal
in Frankfurt ansässig gewesen war, bei seinem Tod aber in hanauischen
Diensten stand, und seine Witwe nun nach Frankfurt zurückkehrte;
zumindest lebten alle ihre vier erwachsenen Kinder 1357 bereits in
Frankfurt, und wenigstens eine Tochter war mit einem Mann aus dem
Frankfurter Patriziat verheiratet. Eine andere Tochter Culmanns, die Begine Liebel
Hartrad von Dieburg („Liebel Hartradin von Dypurg“), kaufte
im Juni bzw. November des Jahres 1357 von den Erben Gerlachs zum
Hohenhaus für 2.000 Mark das Haus zum
Laderam am Frankfurter Römerberg und übergab es ihrer Mutter Hille
auf Lebenszeit zur Wohnung. Mit
dem Haus Laderam hatte die Familie eine repräsentative Liegenschaft
erworben: direkt an das Haus zum Römer stoßend (das seit 1405
Rathaus der Stadt und später Beratungsort der Kurfürsten bei der
Königswahl war), diente es wiederholt dem Kaiser als Wohnung, wurde
1495 Sitz der ‚Adeligen Ganerbschaft des Hauses Alten-Limpurg‘,
nach der es fortan benannt wurde, und ist seit dem Verkauf an die
Stadt 1878 selbst Teil des Frankfurter Rathauses, des ‚Römers‘.
Es gehört heute zu den wenigen im Kern mittelalterlichen Gebäuden
Frankfurts, die nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs
rekonstruiert wurden und eine Ahnung vom historischen Gesicht der
Stadt geben.
 
Historische Aufnahme des Römerberges in Frankfurt am Main. Von den drei Häusern mit Treppengiebel ist das mittlere das ursprüngliche Haus
Zum Römer, seit 1405 Rathaus der Stadt. Links daneben das Haus
Alten-Limpurg, ehem. Laderam.

Von Liebels
Geschwistern kennen wir Jutte, Hans und Else. Jutte
Hartrad von Dieburg, nach ihrem Haus meist Jutte zum Laderam
genannt, war 1357 mit dem Patrizier Dietwin zum Römer verheiratet,
einem Sohn Hartmuts zum Römer; der Ehe entsprangen eine mit dem Alten-Limpurger Patrizier Heinrich
Schwarz von Friedberg verheiratete und 1397 verstorbene Tochter
sowie der 1395 verstorbene Sohn Contze zum Laderam (Fichard:
Geschlechtergeschichte, fasz. 243 „zum Römer“).
1363 war Jutte in zweiter Ehe Frau des Eliseus Weiß von Limburg (Eliseus
zum Laderam), eines Sohnes des Reichsschultheißen Rulmann Weiß und
der Clara Knoblauch; mit ihm hatte sie eine Tochter Clara, die 1385
mit Henne Frosch verheiratet war und 1396 kinderlos starb (Fichard:
Geschlechtergeschichte, fasz. 342 „Weiß von Limburg“). Aus der Ehe des Hans
Hartrad („Hanczil Hartrad“, „Hanczel Culmann“) mit Yde ging
eine Tochter Hille Hartrad von Dieburg hervor, die mit Jeckel Knoblauch (Jakob
Knoblauch dem Jungen) verheiratet war, einem Sohn des reichen
Patriziers und Bürgermeisters Jakob Knoblauch und Schwager des
Reichsschultheißen Siegfried zum Paradies; Jeckel war Frankfurter
Schöffe, wurde aber 1396 wegen Anstiftung von Bürgerunruhen
abgesetzt und zeitweilig im Saalhof, dem Sitz der Familie Knoblauch,
unter Hausarrest gehalten.
Else
Hartrad schließlich war 1357 mit Heinrich zum Culmann
verheiratet. Das Haus zum Culmann ist das spätere Haus zur Goldenen
Waage am Markt; es trug seinen Namen seit Anfang des 14.
Jahrhunderts nach einem Goldschmied Conrad oder Culmann. Dieser
Heinrich zum Culmann ist nach Friederichs (1969, S. 16) und Fichard
(Geschlechtergeschichte, fasz. 316 „zu Waldecke“) derselbe, der
als Mann Elses unter dem Namen Heinze zu Waldeck oder zu Waldecke(n)
vorkommt (nach Friederichs zuerst 1357, nach Fichard zuerst 1361). Das Haus zum Waldeck stand am
Krautmarkt, nicht weit vom Haus zum Culmann. Sofern Heinrich zum
Culmann und Heinze zu Waldeck tatsächlich personengleich sind, wird
die Familie Ende der 1350er-Jahre vom einen Haus in das andere
umgezogen sein; vielleicht hat auch Else das Haus zum Waldeck mit in
die Ehe gebracht. Friederichs lässt Else Hartrad bereits 1380 Witwe
Heinzes zum Waldeck sein, was sicher falsch ist, denn Heinze lebt noch 1380, 1384 und
1387 (s. u.). Dietz wiederum erwähnt in
seiner Frankfurter Handelsgeschichte (S. 170 und 180) einen 1357 erstmals
bezeugten und 1390 als verstorbenen bezeichneten Heinzchen
Hartrad zu Waldeck aus Dieburg am Frankfurter Krautmarkt;
dieser, Schwiegervater des Patriziers
Adolf Knoblauch, war ‚Gadenmann‘, d. h. Tuchhändler, und
versteuerte ein ansehnliches Vermögen von
4.200 Pfund Heller. Die Gadenleute bildeten damals die
Spitze der Kaufmannschaft; ihre Verkaufsstände befanden sich unweit
des Krautmarktes ‚unter den Tuchgaden‘. Dass die Familie Heinze
zu Waldecks aus Dieburg stammte, ist gut möglich. Bei Fichard
findet sich als Sohn Heinzes noch ein zweiter, wohl 1427 verstorbener
Heinze Waldeck von Dieburg (d. J.), dessen Kinder wiederum nach seinem Tod unter
der Vormundschaft des Heinz zum Römer standen; letzterer ist, da er
als „nächster ‚Magen und Freund‘“ seiner Mündel bezeichnet
wird (Friederichs 1969, S. 16), als ein naher Verwandter des Heinze Waldeck
d. J. zu betrachten. In Erfurt immatrikulieren sich noch 1437 und
1464 zwei Studenten mit Namen Johannes Waldeck von Dieburg,
vielleicht Vater und Sohn. Unklar ist aber der nur bei Dietz
auftauchende Beiname „Hartrad“ für den Gadenmann Heinze zu
Waldeck, bei dem es sich ja zweifellos um den Mann Else Hartrads
handelt. Sollte Heinze wirklich zu den Dieburger Hartrad zählen, so
nur zu einem von Heilmann oder Rulmann herstammenden Zweig. Für
wahrscheinlicher halte ich allerdings,
dass Heinze
lediglich den Namen seiner Frau geführt hat; vielleicht liegt bei Dietz
auch ein Fehler vor, denn in Fichards Geschlechtergeschichte (fasz.
316 „zu Waldecke“) kommt Heinze nie mit dem Namen „Hartrad“
vor. Heinzes und Elses Kinder sind nach Fichard: (1) der schon
genannte jüngere Heinze, 1386 Bürger, verheiratet mit Gunda, mit den Kindern Heinz, Else (die vielleicht mit Heinz zum Römer verheiratet ist), Henne, Adolf und Gunda;
(2) Adolf, der im Frankfurter Einwohnerverzeichnis von 1387 als Sohn
Heinrichs zu Waldecken erscheint (Andernacht/Stamm,
S. 164), 1395 verstarb und eine 1413 erwähnte Tochter Else
hinterließ; (3) Liebele, 1398 und 1406 Nonne im Weißfrauenkloster;
und (4) Hille, verheiratet mit Adolf Knoblauch, Sohn des Gypel
Knoblauch zum Bornfleck; über seine Mutter Adelheid, eine Schwester
des Eliseus Weiß von Limburg, war Adolf zugleich ein Neffe Jutte
Hartrads (vgl. Fichard: Geschlechtergeschichte, fasz. 342 „Weiß
von Limburg“ und 165 „Knoblauch“). Zur Nachkommenschaft Else
Hartrads und Heinze Waldecks gehören vielleicht noch Ludwig Waldeck,
der 1470 Frankfurter Ratsschreiber, 1480 Stadtschreiber wird und 1488 stirbt, sowie ein
namensgleicher Ludwig Waldeck aus Frankfurt, der 1485 in
Erfurt, 1487 in Heidelberg als Student eingeschrieben war.
Von den weiteren
Geschicken der Geschwister Liebel, Jutte, Hans und Else Hartrad und
ihrer Mutter erfahren wir zwischen 1357 und 1387 noch des öfteren,
meist anlässlich der zahlreichen Besitzveränderungen am Haus Laderam. Gemäß der
Vereinbarung zwischen Liebel und ihrer Mutter Hille sollte das Haus
nach Hilles Tod zu gleichen Teilen an ihre vier Kinder sowie deren
Ehepartner fallen. Wann dies geschah, ist mir nicht bekannt.
Hilles Tochter
Jutte kommt bereits 1362 mit dem Beinamen
‚zum Laderam‘ vor (Fichard: Geschlechtergeschichte, fasz. 243 „zum
Römer“), bewohnte das Haus damals aber vielleicht zusammen mit
der Mutter Hille, die noch 1369 lebt (Fichard:
Geschlechtergeschichte). 1372 kaufte Jutte für ihre Kinder
von Gottfried
zum Römer, ihrem Schwager, das Viertel einer Gülte auf dessen Haus.
Hans, auf den
sich wohl der Eintrag eines „Johannes
Hartradi de Dyppurg“
im Nekrolog
des Bartholomäusstifts bezieht
(Fichard: Geschlechtergeschichte), scheint 1380
gestorben zu sein, da am 31. März dieses Jahres seine Tochter Hille
und deren Mann Jeckel Knoblauch ihr ererbtes Viertel am Haus Laderam
um 675 kleine
schwere Gulden an Jutte und Liebel gaben, von denen Else und
Heinrich zu Waldecken noch am selben Tag ein Drittel des
Viertelanteils für 225 Gulden erwarben, sodass das Haus nun den
drei Töchtern Culmanns zu je einem Drittel gehörte. 1387
veräußerten Else und Heinrich ihren Anteil für 800 kleine schwere
Gulden an Jutte, die damit Eigentümerin des gesamten Hauses
geworden zu sein scheint. Vielleicht war inzwischen also auch die
Schwester Liebel gestorben, die 1384 noch einige von ihrer Mutter
stammende, von dieser für ein Seelgerät bestimmte Güter als
Legate an Jutte, Else und Heinrich überschrieben hatte.
Else ist später nach Köln gezogen,
wo sie 1397 eine Jahrrente von Henne Knoblauch bezog (Höhlbaum,
S. 6); im Jahr darauf stritt sie vor dem Frankfurter
Schöffengericht mit Jakob Knoblauch dem Alten um das Haus zum Waldeck, das
sie ihrer Tochter, der Weißfrauennonne Liebele, auf ihre Lebzeiten vermacht
hatte (Thomas/Euler Nr. 45, S. 313f.).
Jutte wiederum wird
in den Schöffenprotokollen von 1390, 1392, 1393, 1394 und 1395 noch
genannt (Fichard: Geschlechtergeschichte, fasz. 243 „zum Römer“),
in einer
Urkunde von 1399 aber als bereits verstorben bezeichnet. Tatsächlich dürfte ihr Tod
noch etwas früher anzusetzen sein, da
1397 Henne Frosch Anteile am Haus Laderam besaß, die er von
seiner 1396 verstorbenen ersten Frau Clara (einer Tochter Juttes aus
zweiter Ehe) geerbt hatte und
nun an seinen Schwager Heinrich
Schwarz von Friedberg, den Mann von Claras Halbschwester, verkaufte.
 
Frankfurter Patrizier im 14. Jahrhundert: Grabmal
Johanns von Holzhausen (†1393) und seiner Frau Guda Goldstein (†1371) im Frankfurter Dom.
Da Erwin Hartrad seit
1392 als Frankfurter Ratsherr bezeugt ist, war er wenigstens ein knappes Jahr lang
Amtskollege Johanns, der seit 1357 im Rat vertreten war, seit 1363 als Schöffe.
größere Ansicht

Die Linie des
Frankfurter Bürgermeisters Erwin Hartrad
Durch ihre
Verwandtschaft und Verschwägerung mit einigen der wichtigsten
Frankfurter Patrizierfamilien des ausgehenden Mittelalters waren die
Hartrad in eine gesellschaftliche Position gelangt, die eine zweite
Linie der Familie gegen Ende des 14. Jahrhunderts auch politisch zu
nutzen verstand. Besonders die mehrfache Verbindung zu den
Knoblauch, einem der ältesten Frankfurter Geschlechter, wird dabei
nicht von Nachteil gewesen sein: Jakob Knoblauch – der
Schwiegervater von Hans Hartrads Tochter Hille, zudem Onkel von Jutte Hartrads
zweitem Mann Eliseus Weiß – war nicht nur einer der damals
reichsten Bürger der Stadt, sondern verfügte auch über
herausragende politische Kontakte; seit 1333 besaß er den Saalhof,
die alte staufische Frankfurter Königspfalz, und Kaiser Ludwig der
Bayer, der bei seinen Besuchen in Frankfurt des öfteren bei ihm
wohnte, machte ihn 1334 ebenso zu seinem Hofdiener wie 1349 Kaiser
Karl IV. Jakobs Schwiegersohn wiederum, Siegfried von Marburg zum
Paradies – der Schwager der beiden Hilles –, war eine Generation
später die bedeutendste Persönlichkeit der Reichstadt; 1366 löste
er das bis dahin an die Herren von Hanau verpfändete Frankfurter
Reichsschultheißenamt aus, trat den Besitz 1372 an die Stadt ab und
kann somit als Begründer der bis 1806 währenden Unabhängigkeit
Frankfurts gelten.
Erwin Hartrad zum
Dorrenbaum und seine Familie
Als ersten
Angehörigen des zweiten Frankfurter Zweiges der Familie Hartrad
finden wir um die Mitte des 14. Jahrhunderts Erwin
Hartrad zum Dorrenbaum, der sich mit einem Vermögen von 6.100
Pfund Heller zu den wohlhabendsten Bürgern der Stadt zählen konnte
(Dietz, S. 170); im Beedebuch von 1354 steht er unter den Steuerzahlern an 21.
Stelle (Kriegk 1862, S. 477 Anm. 4). Sein Haus
zum dürren Baum (das spätere Stammhaus der Patrizierfamilie Monis)
stand an der Einmündung der Falkengasse in den Kornmarkt, die
heutige Buchgasse, unweit St. Leonhard. Im Jahr 1346 testiert Erwin
Hartrad eine Urkunde, mit der die Frankfurter Bürgerin Else Schwalbächer umfangreiche Güter in Gronau, nördlich zwischen
Frankfurt und Hanau in der Wetterau gelegen, erwirbt. 1355 ist
Erwin zweimal Zeuge von Beurkundungen vor Frankfurter Notaren (Frankfurter Stadtarchiv, Leonhardsstift: Urkunden und Akten des Stifts und des Rats, 43
und 44). 1358 leiht
Erwin dem Johann
von Falkenstein-Münzenberg 40 Gulden Frankfurter Währung, wofür Johann den Anselm von Hoch-Weiselt d. J. und Henne Feizte, Bürger zu Butzbach, zu Bürgen setze.
1366
übergeben Erwin und seine Frau Agnes ihr Haus am Kornmarkt an den
Schöffen Henne
Drutmann, den Ehemann ihrer Tochter Katherine,
die in diesem Jahr verstorben ist; aus der Ehe Katherines und Henne
Drutmanns ging ein Sohn Henne hervor, der 138(0) mit Rule zum
Hohenhaus verheiratet ist (Fichard: Geschlechtergeschichte, fasz. 67
„Drutmann“). Eine weitere Tochter Erwins, Hebel (†
nach 1417), war 1389 mit Werner Faut von Monsberg verheiratet. Ein Henne
Hartrad, der im Frankfurter Einwohnerverzeichnis von 1387 als kremer
aufgeführt ist (was unterschiedslos sowohl den Kleinhändler wie
den Handelsmann bezeichnete), könnte ein Sohn Erwins zum Dorrenbaum
gewesen sein (Andernacht/Stamm, S. 163). Fichard
(Geschlechtergeschichte) findet Erwin Hartrad in einer Urkunde von 1371
als Frankfurter Schöffen, hält diese Nachricht aber für unrichtig; allenfalls
sei es möglich, dass Erwins gleichnamiger Sohn, der später
Schöffe wurde, in diesem Jahr in den Rat gekommen sei. Ich weiß
allerdings nicht, was dagegen spricht, dass auch schon Erwin zum
Dorrenbaum das Schöffenamt innegehabt haben soll. Wohl dieser
ältere Erwin begegnet urkundlich noch 1373 und 1375 (Fichard) und
dann letztmals im Einwohnerverzeichnis von 1387 (Andernacht/Stamm,
S. 157).
Erwin Hartrads Sohn, der als Erwin Hartrad ‚der Junge‘ siegelt, erscheint im nämlichen Verzeichnis zum
ersten Mal (Andernacht/Stamm, S. 151). 1393 verkauft er eine Ewiggülte von
½ Mark, die er von seinem Vater geerbt hatte (der also
möglicherweise in diesem Jahr verstorben war). 1391 und 1392 findet
sich außerdem ein weiterer Erwin Hartrad als Schaffner zu St.
Kathrinen, der entweder mit Erwin d. J. personengleich ist oder aber
dessen älterer Bruder gewesen sein mag.
Erwin Hartrad d.
J. als Frankfurter Schöffe
Zu dieser Zeit
begann die politische Karriere Erwin Hartrads d. J., der seit 1392
als Frankfurter Ratsherr erwähnt wird. Der Rat der Stadt war damals
in drei Bänke geteilt: die erste, vornehmste Bank der Schöffen,
denen auch die Gerichtspflege oblag, die zweite Bank der
patrizischen Ratsherren und die dritte Bank der Zünfte. Zutritt zur ersten und zweiten Bank, deren Sitze nicht
durch Wahl, sondern durch Selbstergänzung vergeben wurden, hatten
nur die Mitglieder der ‚Gemeinde‘: die nicht zunftmäßig
organisierten Bürger (zu denen auch Erwin Hartrad zum Dorrenbaum
und sein Sohn gehörten), in der Hauptsache also die vermögenden
Grundbesitzer und Handelsleute. Aus den Reihen der zweiten Bank wurden
im Regelfall die Mitglieder des Schöffenkollegiums genommen, das nur
einer kleinen Anzahl auf sozialen Abschluss bedachter patrizischer
Geschlechter offenstand, sodass die dritte Bank der Handwerker kaum
politisches Gewicht entwickeln konnte. Der Druck der wirtschaftlich
erstarkenden Zünfte führte seit 1355 zu vorübergehenden Reformen,
1364/65 sogar zu einem Handwerkeraufstand, maßgeblich befördert
durch den Reichsschultheißen Heinze im Saale und den Wollweber
Andreas Heilegeist, der es bis zum Bürgermeister gebracht hatte.
Auf der patrizischen Gegenseite stand in diesen Jahren insbesondere
Siegfried zum Paradies, der vom Kaiser schon 1366 eine
Unterdrückung aller demokratischen Bestrebungen und die
vollständige Wiederherstellung der alten Verhältnisse erreichte.
Trotz gewisser Zugeständnisse des Patriziats an die Handwerker, vor
allem nach der Niederlage Frankfurts im Süddeutschen Städtekrieg
1389, blieben alte Missstände bestehen. So weigerten sich die
patrizischen Geschlechter nach wie vor, erledigte Schöffenstellen,
die sie als Familienpfründe ansahen, neu zu besetzen, solange kein
Nachfolger aus der eigenen Familie zur Verfügung stand; stattdessen
ließ man den Schöffenstuhl vakant, bis ein geeigneter Kandidat
volljährig geworden war. Die Nachwahlen wurden freilich auch durch
Zwistigkeiten innerhalb des Patriziats selbst verzögert; Ende des
14. Jahrhunderts war es namentlich Jakob (Jeckel)
Knoblauch der Junge (der Schwiegersohn Hans Hartrads aus der
Culmannschen Linie), dessen Privathändel mit verschiedenen
Ratsfamilien erheblichen Streit ins Schöffenkollegium brachten.
Jeckel Knoblauch war es auch, der sich im Jahr 1395, als von 14
Schöffenstellen nur neun vergeben waren, klagend an König Wenzel wandte, der daraufhin die sofortige
Besetzung der fünf freien Plätze auf der Schöffenbank anordnete.
Zu den fünf auf königlichen Befehl ins
Schöffenamt gewählten Ratsherren gehörte Erwin Hartrad (vgl.
Fichard 1819, S. 314), der auch seit März 1395 als Frankfurter Schöffe
urkundete. Er scheint allerdings ebensowenig zur Partei Jeckel
Knoblauchs gehört zu haben wie die übrigen vier neuen Schöffen,
da Jeckel, angeblich unzufrieden mit der Wahl, noch im selben Jahr erneut den
Kaiser anrief und die Ernennung einer kaiserlichen Gesandtschaft
erreichte, die die Zustände im Frankfurter Rat untersuchen sollte
(vgl. zu Erwins Tätigkeit als Schöffe die zahlreichen von ihm
testierten Urkunden im Frankfurter Institut für Stadtgeschichte,
Regesten im Urkundenbuch oder online über www.ifaust.de/isg;
außerdem die Nachweise bei Janssen, Rödel und Thomas/Euler).
1398 wird Erwin
Hartrad bei
Verhandlungen Frankfurts mit den Städten Friedberg und Gelnhausen
als Mitglied des Frankfurter Landgerichts genannt („Erwin Hartdrat,
unser myddescheffin und ratgeselle, der in lantgerichte phliget zu
siczen“); im selben Jahr war er stellvertretender Bürgermeister
(für Gerbrecht von Glauburg oder Konrad Weiß), in der Amtsperiode
1400/1401 dann Vertreter des Heinrich Weiß zum Weißen als Zweiter
(Jüngerer) Bürgermeister. Als der Rat der Stadt im Jahr 1401 den
Beschluss fasste, das baufällig gewordene alte Rathaus am Dom durch
einen Neubau am Römerberg zu ersetzen, berief er Erwin Hartrad d.
J. zum Bumeister (Baumeister), der die Planungen vorantreiben sollte.
Tatsächlich wurde noch im selben Jahr ein Modell gefertigt und eine
Schiffsladung Steinquader aus Miltenberg beschafft. Schon wenig
später scheint man das Vorhaben allerdings fallengelassen zu haben;
im Stadtrechenbuch sind seit 1402 nur mehr kleinere Ausgaben für
das Projekt verzeichnet (vgl. Battonn S. 211), und 1405 hatte man mit dem Ankauf des
Hauses zum Römer und seinem Umbau zum Sitzungslokal eine
kostengünstige Alternative gefunden. 1404 ist Erwin, zusammen mit dem Ratsherrn Clas Landskron, der erste namentlich bekannte Pfleger der Nikolai-Kirche am Römerberg (vgl. Becher/Fischer S. 133). 1408 wird er gleich nebenan die erste Stadtratssitzung im neubezogenen Rathaus miterlebt haben.

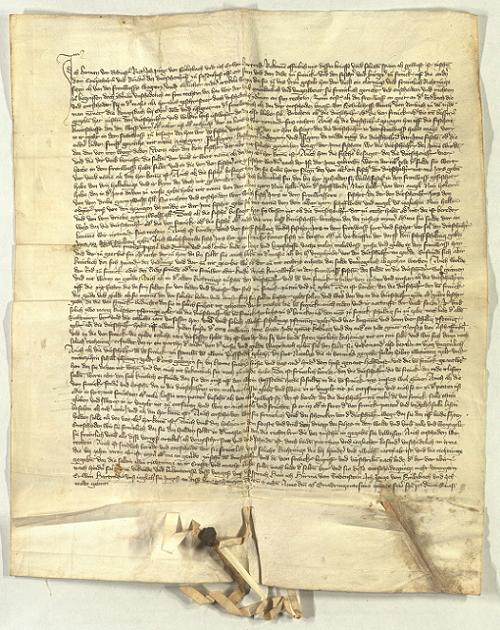
Urkunde
von 1404, mit der Hermann von Rodenstein, Jörg von Sulzbach und Erwin Hartrad
einen Vergleich zwischen dem Deutschordenshaus zu Sachsenhausen und
der Stadt Frankfurt schließen (Deutschordenszentralarchiv Wien; Quelle: monasterium.net. Das virtuelle Urkundenarchiv Europas)
| große Ansicht

Erwin Hartrad d.
J. und der Frankfurter ‚Wessil‘
1402 wurde Erwin
Hartrad zum Ersten (Älteren) Bürgermeister
und somit zum faktischen Stadtoberhaupt der
Reichsstadt Frankfurt gewählt (formelles Oberhaupt waren der Kaiser
und sein Stellvertreter, der Reichsschultheiß). In Erwins einjährige Amtszeit fällt
die Gründung des ersten Frankfurter Bankhauses, des ‚Wessils‘,
durch den Rat der Stadt (vgl. Kriegk 1862 / Rothmann, v.a. S. 273-280 /
Bothe, S. 174f. / Poschinger, S. 7-13
[Auszug als PDF]).
Kaiser Karl IV. hatte der Stadt bereits 1358 zusammen mit der Aufsicht über die Goldmünze auch das Recht auf den Geldwechsel übertragen, nicht aber das ausschließliche Privileg dazu. Abgesehen davon, dass mit dem Wechselgeschäft guter Gewinn zu machen war, den die Stadt nicht mit privaten Wechslern teilen wollte, sah sie auch die Funktionsfähigkeit der kommunalen Münzstätte in Gefahr: bot der Wechsel doch die einzige Möglichkeit, sich mit dem für die Münzprägung nötigen Edelmetall in ausreichender Menge zu versorgen. Im August 1402 schrieb der Frankfurter Rat deshalb dem König, er möge niemandem als der Stadt den Wechsel gestatten. Noch bevor der König dieser Bitte Anfang September nachkam, hatte der Rat freilich zur Selbsthilfe gegriffen und am 29. August beschlossen,
„daz ein iglicher, er sii monczmeister, goltsmydt, (kremer) oder wesseler, (burger oder gast) zu Franckenfurd, gold und silber, (perlin, aczstein, pagement, garnalien oder dergleichen) keuffen oder virkeuffen mögen“,
dies auf der städtischen Gold- und Silberwaage zu tun hätte. Freier Wechsel war fortan nicht mehr gestattet und wurde unter Strafe gestellt:
„Wer auch gulden oder silbern moncze keuffte oder virkeuffte oder wessil besesse und geverlichen driebe uszwendig der stede wessil, den wil der rat an libe und gude also strafen, daz sich ein ander daran
stosse“ (zit. nach Rothmann, S. 277). Die Stadt schoss ein Kapital
von 900 Gulden in das Unternehmen, das durch private Einlagen vermehrt
wurde, und sorgte für die Ausstattung der Bank, die nach heutigen Maßstäben bescheiden anmutet: als Wechselstube fungierte eine
Bretterbude an der Nikolaikirche, für die die Stadt
„eine Goldwaage, mehrere Waagen für gemünztes und ungemünztes Silber, zwei große Tische aus Nußbaum, zwei Laden zur Aufbewahrung des Geldes, eine Kiste zum Kassieren des Wiegegeldes, einen ‚Kebig‘
und vier Schirme“ erwarb (Rothmann, S. 277). Außerhalb der Messezeiten, zu denen 14 Personen in der Bank tätig waren, genügte ein einziger Verantwortlicher für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs. Dieser bestand neben dem Wechsel auch aus Depositen-, vielleicht auch schon aus Darlehensgeschäften. Eine erste Bilanz ist aus dem November 1402 erhalten: auf die städtische Einlage von
900 fl. war während der Herbstmesse ein Gewinn von 90 fl. erwirtschaftet worden. Trotz der guten Rendite wurde der städtische Wessil
aber schon im darauffolgenden Jahr aufgelöst und in vier Einzelgesellschaften
überführt: eine Bank unter städtischer Verwaltung, zwei
Privatbanken und eine Kommanditgesellschaft, an deren Gewinnen die Stadt beteiligt war.


Der Frankfurter Römerberg mit der Nikolaikirche; hier befand sich 1402 der
Wessil, die erste Bank der Stadt. Rechts die Häusergruppe des Römers. Kupferstich nach Salomon Kleiner,
1728 | große Ansicht

Erwin Hartrad d.
J. als Frankfurter Gesandter
Seit 1398 vertrat Erwin die Stadt Frankfurt des öfteren als Gesandter auf Reichsversammlungen und zu anderen Anlässen (vgl. dazu die zahlreichen Nachweise in den von Julius Weizsäcker bearbeiteten Deutschen Reichstagsakten, aus denen ich im folgenden zitiere; die Nummern beziehen sich auf die im Literaturverzeichnis näher bezeichneten Bände). Über die Anlässe der Reisen und ihre Kosten sind wir aus den Frankfurter Stadtrechnungen gut informiert. So ist Erwin 1398 mehrmals in Mainz, um über den Reichslandfrieden zu verhandeln, den König Wenzel auf dem Hoftag zu Frankfurt im Dezember 1397 und Januar 1398 erneuert hatte. Für den 30. März 1398 heißt es: „23 lb. [Pfund] virzertin her Sibold Lewin Jacob Weibe Erwin Hartrad und ein schriber und vier zolner als von des lantfriden wegin vier tage zu Mentze“ (3, S. 72); am 6. April desselben Jahres: „4 ½ lb. virzerte Erwin Hartrad mit eim schriber und mit eim knechte dri tage gein Mentze, als die sieben [Kurfürsten] uber den lantfriden swuren“ (3, S. 72); und am 14. Dezember: „16 lb. virzerten Jacob Weibe Erwin Hartrad und Johan Erwin selbachte vier tage zu unserm herren von Mentze als von des von Falkenstein und der zolle wegen und auch zu gespreche von lantfrids wegen“ (3, S. 73). Im April 1399 ist Erwin mit einer Frankfurter Abordnung auf dem Kurfürstentag zu Boppard, „als die fürsten ein gespreche da hatten“, zu dem der Landfriedenshauptmann „grave Philips [von Nassau] der lantvoigt“ sie „dar virbodet hatte“ (3, S. 88); im Juni reist er „selbseßte … von einer heimlichen sache wegen“ nach Mainz (3, S. 97); im September besucht er den Fürstentag in Mainz, von wo aus seine Delegation den Frankfurter Rat schriftlich darum bittet, ihr für die Rückreise auf dem Main Schutztruppen entgegenzuschicken (3, S. 118); im November ist er erneut wegen des Landfriedens in Mainz (3, S. 139). Im Februar 1400 führt Erwin zusammen mit anderen Frankfurter Stadträten Unterhandlungen mit den Kurfürsten von Mainz, Trier und Köln, dem Pfalzgrafen Ruprecht, dem bayerischen Herzog Stephan, dem Markgrafen Wilhelm von Meißen und dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg über das Geleit zum Frankfurter Fürsten- und Städtetag vom Mai 1400 (3, S. 159f.); im Juli geht es wieder für einige Tage nach Mainz „von heimlichs gesprechs wegin der stede“ (3, S. 214), und im August für gut zwei Wochen „gein Lanstein zu unsern herren den kurfursten“ (3, S. 291).
Was hier in den Rechnungsbüchern so knapp und spröde aufgelistet und gewissenhaft verbucht wird, erzählt tatsächlich ein Kapitel deutscher Geschichte. Denn
schon beim Kurfürstentag in Boppard 1399 hatten Beratungen darüber
stattgefunden, wie gegen die zunehmend als unerträglich empfundene
Regentschaft König Wenzels Abhilfe zu schaffen sei. Auf dem
Frankfurter Fürstentag im Mai 1400 hatte der Mainzer Erzbischof
dann versucht, die Absetzung König Wenzels und die Wahl des Wittelsbacher Pfalzgrafen Ruprecht
zum neuen König durchzusetzen, war aber auf Widerstände gestoßen.
Auch die traditionelle Wahlstadt Frankfurt hatte Ruprechts
Kandidatur abgelehnt. Die vier rheinischen Kurfürsten waren deshalb
nach Lahnstein ausgewichen, wo sie König Wenzel für abgesetzt erklärten und Ruprecht an seiner Stelle zum König
erhoben. Um diesen Plan unter anderem wird es bei den „heimlichen sachen“ und „gesprechen“ gegangen sein, die Fürsten und Städte zuvor in dichter Folge
miteinander gehabt hatten.
Sofort nach dem Sturz Wenzels begann der frischgekürte König Ruprecht, mit
den Städten über seine Anerkennung zu verhandeln; insbesondere war
ihm daran gelegen, in Aachen oder Frankfurt zur Krönung einziehen
zu können. Die Städte ihrerseits beratschlagten unter sich, wie sie mit dem Thronwechsel umgehen sollten.
Frankfurt, das an König Wenzel festhielt und Ruprecht nicht
huldigen wollte, unterhielt deshalb eine Pendeldiplomatie, indem man
gegenüber Ruprecht hinhaltend auftrat und zugleich bei den
Ratsfreunden der anderen Städte mögliche Verbündete sondierte. Schon Ende August
1400 begab sich Erwin zusammen mit Konrad Weiß und sieben andern
nach Alzey „zu herzog Ruprecht von beiern, als er sich des richs underzoch und nach des rads frunden gesant hatte“ (4, S. 129); nachdem er in Frankfurt von den Ergebnissen der Unterhandlungen in Lahnstein und Alzey Bericht erstattet
hatte, reiste Erwin weiter nach Mainz, wohl um für die Einberufung eines Städtetages dorthin zu werben (4, S. 129). Im September
war Erwin zusammen mit Konrad Weiß dann auch tatsächlich „zu dem gespreche mit den steden“ wieder in Mainz (4, S. 134),
nochmals im Oktober mit Konrad Weiß und Jakob Weibe, „als sie bi der stede frunden zu einer ratslagunge waren, als der konig vor der stat lag“ (4, S.
142), und Anfang November mit Jakob Weibe erneut „gein Mencze zu unserm herren dem kunige“ (4, S.
201). Ruprecht hatte nämlich inzwischen sein Lager vor Frankfurt
aufgeschlagen, um die Huldigung der Stadt zu erzwingen. Der Rat
indes blieb vorerst bei der Partei Wenzels und schrieb nach Prag um
Unterstützung. Erst als davon auch nach mehr als sechs Wochen
nichts zu bemerken war, sah Frankfurt sich an den Eid auf König
Wenzel nicht mehr gebunden und öffnete Ruprecht die Tore.
Penibel verzeichnet das Rechnungsbuch die Gastgeschenke, die man dem König und der Königin überreichte, und deren Kosten: für Ruprecht unter anderem „ein virgulte fleschen (…) die koste hundert gulden 7
gulden, und einen zwiefeldigen virgulten koph, der (…) koste 83 gulden 6 hl.“, dazu Rheinwein und Elsässer Wein zu 22 und 30 Gulden, für seine Frau
Elisabeth „ein virgulte kannen, die koste 78 gulden (…), und ein virgulten zwifeldigen
koph, der (…) koste 75 gulden 16 sh.“, dazu wieder Weine zu 22 und 30 Gulden; „vier silbern duche“ für Ruprechts Söhne schlugen nochmals mit 80 Gulden zu Buche, „dru gulden duche“ für die Gräfin von Cleve mit 78 Gulden; die geistlichen Kurfürsten erhielten Wein zu 66 Gulden, die übrigen Herren und Räte Wein zu insgesamt 100 Gulden; dazu kamen noch Auslagen von je einem Gulden für die acht „piffern und bosumern“ (Pfeifer und Posaunisten) und die vier „innersten dorhuter“ sowie je einem halben Gulden für die „zwein ußersten dorhuter“ und die „seß leufer unsers herren des kuniges“; alles zusammen gut 800 Gulden (4, S. 201). Die Reisespesen, die Erwin und seine Ratsfreunde abzurechnen hatten, muten dagegen recht bescheiden an.
Während
Frankfurt nun auf die Seite Ruprechts übergegangen war, verweigerte
sich die Krönungsstadt Aachen nach wie vor dem Einzug des neuen Königs.
Wieder entfaltete Frankfurt eine diplomatische Tätigkeit nach zwei
Seiten hin, diesmal, um zwischen dem König und Aachen zu
vermitteln: Im Dezember reiste Erwin mit einigen andern nach Mainz „zu unserm herren dem konige (…), als er und der fursten ein deil da bi ein waren“ (4, S.
232); und im Januar 1401 mietete man für sechs Pfund ein Pferd, „daz Erwin Hartrat gein Colne reit und gein Aiche [Aachen] geridden solde sin von unsers herren konig Ruprechts wegen in inzulassen“ (4, S.
233). Was Aachen betraf, blieben die Bemühunge allerdings
vergeblich, sodass Rupprecht im Januar 1401 in Köln gekrönt werden
musste.
Kaum war das
geschehen, traf Ruprecht im Sommer 1401 Vorbereitungen für einen Romzug, der seine Ansprüche auf die italienischen Reichsteile bekräftigen und die Königsgewalt dort wiederherstellen sollte. Auch die Städte wurden um Hilfeleistungen zu diesem Unternehmen angegangen; Erwin ist deshalb im Juni 1401 mit einer Frankfurter Delegation in Mainz, „als unser herre der konig der stede frunden dar bescheiden hatte und sine rede dar geschicht hatte, die da wurben umb hulfe und dinste unserm herren dem konige gein Lamperten [Lombardei] zu tun“ (4, S. 481), nochmals im Juli, um „unserm herren dem kunige zu antworten von des zoges wegin uber berg“ (ibid.), und im August in Heidelberg wegen derselben Angelegenheit (ibid.). Als Ruprecht im folgenden Jahr mehr oder minder unverrichteter Dinge aus Italien zurückkehrte – nach Rom war er überhaupt nicht gekommen –, gehörte Erwin zu der Frankfurter Gesandtschaft, die den König in Heidelberg willkommen hieß; die Stadtrechnungen verzeichnen Ausgaben für eine siebenköpfige Abordnung „mit sieben pherden (…), als sie unsern herren den konig von des rads und stede wegen, als er von Welschen landen wider herußkommen waz, emphingen (5, S. 343).
Auch in den folgenden
Jahren ist Erwin wieder regelmäßig Gast auf Städte- und Fürstentagen.
Im Juli 1401 reist seine Delegation zu König Ruprecht nach Mainz, „im
der stede notdorft von des bischofes und der paffin wegen zu sagen“
(5, S. 343); Frankfurt nämlich lag mit dem Mainzer Erzstift
wiederholt in Streit über die rechtliche Stellung der Geistlichkeit
innerhalb der Stadt. Im Mai 1403 reist man „mit 27 pherden gein
Winheim uf einen dag, als unser herre der konig und der bischof von
Mentze mit ein leisten“ (5, S. 511), im Juni „mit 30 pherden 14
tage gein Winheim und Heidelberg, als man den dag zu Hemspach leiste
und man mit dem bischof von Mencze und der paffheit zu Franckenfurt
gerichtit wart“ (5, S. 512), im März 1404 zum Kurfürstentag nach
Boppard (5, S. 573), im Dezember 1404 und Oktober 1405 zu Reichstagen
nach Mainz (5, S. 655 und 767), im April 1406 zu einer Versammlung der
wetterauischen Herren und Städte nach Oppenheim, um „von des
lantfrids wegen und auch von andrer sache wegen mit unserm herren
dem konige zu tedingen“ (5, S. 648). Als im März
1406 ein Krieg zwischen Kurmainz und König Ruprecht zu befürchten
ist, reisen Erwin, Heinrich Weiß und ein Schreiber nach Mainz, um
mit dem mainzischen Hofmeister Johann Brymßer und dem Protonotar
Johann Bensheim „in heimlichkeit“ die Haltung Frankfurts zu
besprechen (6, S. 61); in derselben Sache ist Erwin mit Frankfurter
Unterhändlern auch noch zweimal im April und einmal im September in
Mainz (6, S. 64 und 99). Aus dem Sommer 1406 existiert
eine Korrespondenz zwischen Erwin und dem Wetterauer Landvogt
Eberhard von Hirschhorn, welcher im September am Landfriedenstag zu
Frankfurt hätte teilnehmen sollen, sich aber wegen Krankheit
entschuldigt (5, S. 644). Im Oktober 1408 besucht man Mainz, um „von
der monze wegin in heimlichkeit zu redin und zu erfaren“ (6, S.
801), und im März 1409, um „an dem rade zu erfarn was ire
meinunge were unserm herren dem konige von der bebste und auch der
monze wegen zu antwurten, als er darumb den steden schreib“ (6, S.
371); die Einführung einer reichseinheitlichen Goldmünze und die
Überwindung des Kirchenschismas waren zwei zentrale politische
Projekte König Ruprechts, gegenüber denen die Städte eine
gemeinsame Haltung suchten.

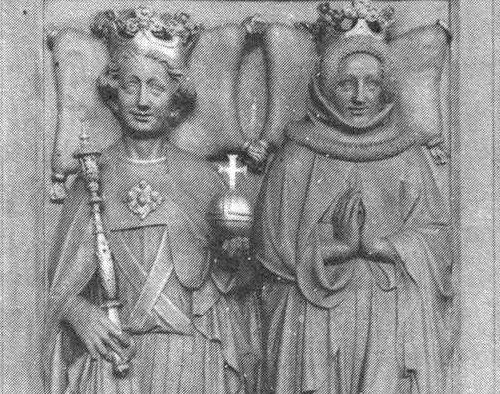
Grabmal König Ruprechts und seiner Gemahlin Elisabeth von Hohenzollern in der Heidelberger Heilig-Geist-Kirche

Das Erbe Erwin
Hartrads d. J.
Im Dezember 1408
sowie von Januar bis
März 1409 fungierte Erwin d. J. als stellvertretender Reichsschultheiß
für Rudolf von Sachsenhausen und urkundet noch bis November 1409
als Schöffe. Da im Januar 1411 das Haus des verstorbenen Erwin
Hartrad am Viehmarkt (heute die Zeil) in der Frankfurter Neustadt
erwähnt wird, fällt Erwins Tod wohl ins Jahr 1410. Johann Carl von
Fichard, der Chronist des Frankfurter Patriziats im 19. Jahrhundert,
erwähnt in seinem Frankfurtischen Archiv das Fragment eines Berichts des
Frankfurter Stadtrates an Kaiser Karl IV. über die Schöffenwahl
des Jahres 1355, das auf seiner Rückseite von neuerer Hand die
Aufschrift trägt: „Diese
Schrift hat man hinder Erwin Hartrad funden“; der Bericht stamme
demnach, fährt Fichard fort, „aus dem Nachlaß dieses Mannes,
eines hiesigen Schöffen, aus altem burgensischen Geschlecht, der
nach gleichzeitigen Nachrichten im Jahre 1410 starb“ (S. 202f.,
das Fragment selbst ist abgedruckt auf S. 227-232).
Mit Meckel Faut von Monsberg
(erwähnt 1387, 1398 bereits verstorben), einer Schwester seines Schwagers Werner Faut von Monsberg (Fichard: Geschlechtergeschichte,
fasz. 80
„Faut von
Monsberg“), hatte Erwin
d. J. eine mit Henne Frosch verheiratete
Tochter Adelheid (Elchin,
† nach 1410, vor 1424; vgl. Froning sowie Fichards
Geschlechtergeschichte). Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1438
vererbte sich ihr Nachlass, für den Henne Frosch das
Nutznießungsrecht besessen hatte, an Adelheids nächste
Angehörige: Eberhard von Praunheim (aus alter Ritter- und
Reichsschultheißenfamilie) mit seiner Frau Meckel, die Patrizier
Herman Appenheimer (aus einer der reichsten Familien Frankfurts )
mit seiner Frau Grede und Henne Brun gen. Faut mit seiner Schwester
Elschin sowie die Bürger Tiel und Meckel Ruting von Kaldebach,
Heinrich und Grede Eber von Miltenberg, Heinrich und Anne Ziegeler
von Miltenberg und Kathrine, Witwe des Michel von Windsbach. Schon im Mai 1438 hatten die Erben Adelheids aus den ihnen zugefallenen Gütern Verkäufe getätigt, sodass sich der Besitz der Verstorbenen wenigstens in Teilen rekonstruieren lässt.
DDemnach hatten die Eheleute Ruting, Eber und Ziegeler sowie Kathrine von Windsbach erhalten: ½ Morgen Gartenland und 2½ Morgen Wiesen in der Lindau, 3 Morgen weniger 1 Viertel Wiesen zu Ginnheim, genannt die gemeine Wiese, sowie 1½ Morgen und 12 Ruten Wiesen zu Ginnheim jenseits des Bachs;
Käufer war für 148 Gulden Henne Brun gen. Faut. Eberhard von Praunheim und seine Frau verkauften einen Monat später, vielleicht also auch aus dem Nachlass Elses, noch 20 Gulden Gülte auf dem „Vayts hof“ am Rossmarkt zu einem Preis von 400 Gulden an Gerbracht von Glauburg, dazu gut 2½ Morgen zwischen dem Riederbruch und dem Main, gut 1½ Morgen am Gutleutkreuz, 2 Morgen hinter dem Affenstein an der Landwehr und weitere Liegenschaften. Zum
Erbe gehörte ferner das Haus Altenburg, gegenüber der Kirche St.
Leonhard an der Stadtmauer, das im Jahr 1398 Adelheids Vater, Erwin d. J., für 80
Pfund und vier Schilling Heller von den Brüdern Adolf und Junge
Weiß gekauft hatte.
Aus einer zweiten
Ehe Erwins d. J. stammte der Sohn Henne
Hartrad, der seit 1412 genannt ist, aber 1438 bereits verstorben
sein muss, da er nach dem Tod seines Schwagers nicht zu den
Nacherben seiner Schwester Adelheid gehörte. Zum Vormund Adelheids
war 1410, nach dem Tod Erwins d. J., ein anderer Henne Hartrad, gen. Krone bestellt worden – wohl ein Bruder
Erwins, der die Pflegschaft zusammen mit Idel Drutmann sowie Else
und Herte Brun, gen. Faut von Monsberg ausübte. Dieser Henne –
vielleicht derselbe, der schon im Einwohnerverzeichnis von 1387 als
Weber Henne Hartdrat erscheint (Andernacht/Stamm, S. 171) – kauft 1430 mit vielen
andern mehrere Gaden im alten Weberkaufhaus, im Jahr darauf ist er
als Wollwebermeister erwähnt (Fichard: Geschlechtergeschichte). Der Beiname Hennes - Krone - kann
sich auf das Haus zur Krone am Kornmarkt ebenso beziehen wie auf
eines der Häuser zum
Kranich (kron, krone) am Römerberg bzw. am Rossmarkt.
Vielleicht
zu den Söhnen (oder Brüdern?) Erwins d. J., vielleicht zu
einer in Dieburg verbliebenen Linie der Hartrad gehört noch ein Heinrich Hartrad
von Dieburg („Henricus Harttradi de Dyppurg“), der sich
1389 während des Rektorats des Wormser Magisters Heilmann
Wunnenberg an der nur drei Jahre zuvor gegründeten Universität
Heidelberg immatrikuliert. Im Frankfurter Einwohnerverzeichnis von
1387, das alle Bewohner im Alter ab zwölf Jahren erfasste, ist er
nicht erwähnt; er hätte demnach - was im Mittelalter durchaus
üblich war - mit höchstens 13 Jahren die Universität bezogen.
Allerdings kann man sich fragen, ob er, sofern aus Frankfurt
gebürtig, nicht eher als „de Franckfordia“ eingeschrieben
worden wäre. In Heidelberg wird Heinrich sicher seinem Landsmann Berthold Truchsess
(Dapifer) von Dieburg begegnet sein, der - nachdem er in Prag zum
Baccalaureus und Magister sponsiert worden war - in Heidelberg
zwischen Juni und Oktober 1390 das Amt des Rektors bekleidete (Drüll,
S. 39).
Möglicherweise personengleich mit dem Heidelberger Studenten Heinrich Hartrad
ist ein „Henricus Hartrodi“, der seit 1393 in Wien studierte
und in der dortigen Matrikel der „Nacio Rynensium“ zugerechnet
wird. Die 1386 errichtete Heidelberger Universität nämlich hatte, bedingt durch den Süddeutschen Städtekrieg sowie den Ausbruch der Pest, bereits 1388/89 eine erste Krise zu bewältigen, die zu einem Rückgang der Immatrikulationszahlen und zum Wegzug zahlreicher Universitätsmitglieder führte. Die meisten Magister und Scholaren gingen an die 1389 eröffnete Universität Köln; denkbar wären als Ausweichorte aber auch Prag und Wien, zumal aus diesen beiden Städten (neben Paris) ein Großteil des ersten Heidelberger Lehrpersonals rekrutiert worden war. Eventuell ist der Wiener Student allerdings zu den Hartrad um Marburg und Rauschenberg zu zählen; denn gleich unter seinem Eintrag folgen in der Matrikel ein Graf Johann von Ziegenhain (bei Schwalmstadt, nordöstlich von Rauschenberg) sowie drei Studenten namens Johann „de Treysa“, „de Hayne“ (Treysa und Haina, beide bei Schwalmstadt) und „de Nydde“ (wohl Nidda in der Wetterau). Andererseits scheinen sich diese vier Johanns gemeinsam eingeschrieben zu haben, während Henricus Hartrodi kurz vorher gleichzeitig mit einem Johannes Balhen in das Studierendenverzeichnis eingetragen worden ist, mit dem Grafen von Ziegenhain und seinem Gefolge also vielleicht gar nichts zu tun hat. Mit „Treysa“ könnte im übrigen auch Traisa bei Roßdorf gemeint sein, mit „Hayne“ Dreieichenhain, beide bei Dieburg.

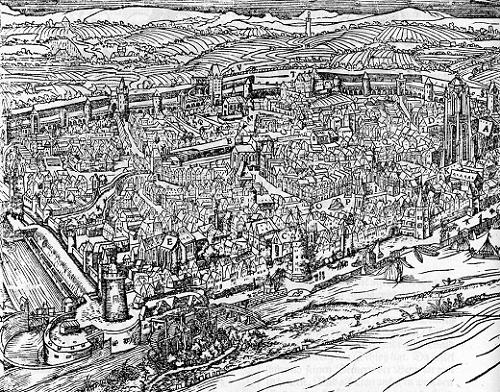
Konrad Faber und Martin Hoffmann: Frankfurt am Main, Holzschnitt in Sebastian Münster:
Cosmographen oder Beschreibungen aller Länder, herrschaftenn und fürnemesten Stetten des gantzen
Erdbodens, Basel 1588, S. 938 | große
Ansicht
Eine noch detailreichere, aber etwas spätere Ansicht
bietet
der Stadtplan Matthäus Merians von 1628.
Übersicht
der Straßen Frankfurts um das Jahr 1350. In Werner Nosbisch (Bearb.):
Das Wohnungswesen der Stadt Frankfurt a.M. Hochbauamt und Wirtschaftsamt der Stadt Frankfurt am Main, Frankfurt am Main 1930.
Gezeichnet auf Grundlage der Stadtbeschreibung Baldemars von Petterweil
(1320–1383) und des Stadtplans von Christian Friedrich Ulrich (1765–1828).
Der Ausschnitt zeigt die Altstadt Frankfurts. Ganz rechts, mit (A) gekennzeichnet, die Bartholomäuskirche. Der offene Platz weiter links (P) ist der Römerberg mit der Nikolaikirche
(I), deren erster Pfleger Erwin Hartrad d. J. war; die Häuserzeile des Römers (mit dem
Hartradschen Haus Laderam) ist auf der linken Seite des Platzes nur von der Rückseite zu sehen. Von der Nikolaikirche schräg rechts zum Main hin erkennt man den spitz gedeckten Turm des Knoblauchschen
Saalhofes, in dem Jeckel Knoblauch, der Mann Hille Hartrads, unter
Hausarrest gestellt wurde. Folgt man dem Main weiter nach links, erhebt sich gleich hinter der Stadtmauer die Kirche St. Leonhard mit ihren zwei charakteristischen Haubentürmen (C). Links neben dem zur Stadtbefestigung gehörenden runden Leonhardsturm führt die Leonhardspforte vom Mainhafen mit seinen Verladekränen zum langgestreckten Kornmarkt, dem bis zur Katharinenpforte ganz im Norden
reichenden Straßenzug, an dem die Frankfurter Patrizier bevorzugt ihre Stadthäuser errichteten. Am unteren Ende des Kornmarktes, gleich bei St. Leonhard, lag das Haus Altenburg, in seinem weiteren Verlauf folgten die Häuser zum dürren Baum
- der Stammsitz Erwin Hartrads d. A. - und Heiligenstein. Rechts von der
Katharinenpforte, am oberen Ende des Kornmarktes, steht die
Katharinenkapelle, der Vorgängerbau der heutigen Katharinenkirche;
Erwin Hartrad d. J. wurde hier bestattet. Weiter nach Osten (rechts) folgt die Liebfrauenkirche; das auffällige steinerne Haus mit hohem Walmdach
gegenüber der Kirche ist das Haus zum Grimmvogel, das zusammen mit
dem benachbarten Haus zum Paradies Wohnsitz des Reichsschultheißen
Siegfrieds zum Paradies war. Vom Liebfrauenberg führt die Neue Kräme zurück nach Süden zum Römerberg.

Genealogische
Fragen
Nicht sicher ist die verwandtschaftliche Zuordnung einer
Elheit (Adelheid) Hartrad. Im März 1379 führten der Dominikanerprediger Peter
Dufel und seine Schwester Christine, Kinder der Katherin Dufel, Klage gegen sie wegen des Hauses zum Heiligenstein am Kornmarkt, das sie als ihr vermeintliches Erbe
herausforderten. Elheit erwiderte, sie habe das strittige Haus noch zu Lebzeiten ihres Mannes an die fünf Jahre und ebensolang auch nach dessen Tod besessen, ohne dass jemand rechtliche Ansprüche darauf erhoben hätte; die Klage wurde abgewiesen (Institut für Stadtgeschichte Frankfurt, Stalburg Archiv: Urkunden 17). Im Juni 1379 werden dann Heintze zu der Leiter und seine Frau Alheid als Verkäufer einer Ewiggült auf
dem Haus Heiligenstein erwähnt (was nicht notwendig heißt, dass
die beiden das Haus auch besaßen); als Schwester Alheids erscheint in derselben Urkunde eine Katharina, Tochter des Nyclaus Hartunch, bei dem es sich wohl um den Bäcker und Ratsherrn Klaus Hartung handelt (Institut für Stadtgeschichte Frankfurt, Stalburg Archiv: Urkunden 18). Im März des darauffolgenden Jahres (1380) ist das Haus Heiligenstein schließlich im Besitz der Erben des verstorbenen
Jakob Milwer – nämlich Henne Milwer, seiner Schwester
Katharina Hartrade und der minderjährigen Geschwister Madern und Gude –, die es an Irmel Gulde verkaufen (Institut für Stadtgeschichte Frankfurt, Stalburg Archiv: Urkunden
19; zwei Mitglieder der reichen Wollweberfamilie Milwer, Henne und Heile,
waren 1364/65 bei den treibenden Kräften des Bürgeraufstandes
gewesen).
Später - 1431 - gehört das Haus Heiligenstein dann der Ele Schußhanen (Adelheid Gulden zum
Schußhan), Witwe des Stadt- und Dombaumeisters Madern Gerthener, als diese ihr Testament errichtet (Institut für Stadtgeschichte Frankfurt, Stalburg Archiv: Urkunden 40).
Der genaue Erbgang des Hauses, vor allem die Verwandtschaftsbeziehung zwischen Adelheid und Katharina Hartrad, ist mir unklar.
Der Besitz des Hauses scheint von Adelheids um 1374 verstorbenem
Mann herzurühren; Katherin, verh. Dufel, wird dessen Schwester,
also Adelheids Schwägerin gewesen sein. Vielleicht war Adelheid in
zweiter Ehe mit Jakob Milwer verheiratet und vererbte das Haus an
ihre Stiefkinder; Adelheid und Jakob müssten dann 1379/80 kurz
hintereinander gestorben sein. Ob Adelheid eine geborene Hartrad
gewesen ist, lässt sich leider nicht sagen, ebensowenig, mit
welchem Hartrad Katharina, geb. Milwer verheiratet war.
Verwirrend kommt hinzu, dass auf dem Kornmarkt, also in unmittelbarer Nachbarschaft des Hauses Heiligenstein, zwischen 1317 und 1336 ein Bäcker Hartrad mit seiner Frau Jutta und zahlreichen Söhnen – Hartrad, Wortwin, Konrad, Hermann und Drutmann, genannt der Blinde – bezeugt ist;1 dieser Bäcker Hartrad steht mit der Dieburger Familie nicht in Beziehung, ist aber vielleicht mit dem o. g. Bäcker Klaus Hartung verwandt, da zu seiner Familie auch ein Hartung gehört („Hartungus gener. Harttradi pistoris“, 1317), der 1340 als Hartung Becker auftritt.
Diese Umstände
sowie die zahlreichen Besitzungen Erwin Hartrads d. J. und seiner
Angehörigen rund um den Kornmarkt haben Johann Carl von Fichard darauf gebracht, in
seiner Frankfurter Geschlechtergeschichte die Erwinsche Linie als
eigene, mit den Dieburger Hartrad nicht verwandte Familie zu
behandeln. Gegen Fichards
Ansicht aber sprechen eine Reihe von Argumenten, die er zum Teil sogar
selbst referiert. In der Tat kann
Erwins
Vater, Erwin zum Dorrenbaum, kein Sohn Culmann Hartrads
gewesen sein, da er bei den Erbschaftsangelegenheiten um das
Haus Laderam nicht erwähnt wird. Als Neffe Culmanns aber
käme er durchaus in Betracht, sei es über Rulmann, sei es über
Heilmann Hartrad, die Fichard beide nicht kennt. Ohnehin ist schon bei dem 1341 ohne Vornamen in den Schöffenprotokollen erwähnten N.N. Hartrad von Dieburg durchaus nicht zwingend, dass es sich hier um Culmann handeln muss, der ja zusammen mit seiner Frau urkundlich noch 1340 und 1345 stets als Bürger Dieburgs vorkommt; warum sollte man es hier nicht mit Heilmann oder Rulmann zu tun haben, von denen in Dieburg seit 1329 bzw.
1334 weitere Nachrichten fehlen? Einen Beleg für die These zweier in Frankfurt ansässiger Hartrad-Zweige
bietet eine von Fichard zitierte Frankfurter Akte des Jahres 1360,
in der Henne Drutmann (der Mann von Erwins d. J. Schwester Katharine
Hartrad) als Schwager Ditwins zum Römer (des Mannes der Jutte
Hartrad zum Laderam) bezeichnet ist. Fichard stellt dazu fest, dass als
Schwager jeder Verwandte von Seiten der Ehefrau gelten konnte, und
schließt daraus zunächst auf eine Zugehörigkeit Katharines bzw.
Erwins zu den Dieburger Hartrad; später relativiert er diese
Aussage mit der Bemerkung, die Schwägerschaft könnte auch auf
anderem Wege zustandegekommen sein, ohne freilich Quellen
vorzulegen, die dies wahrscheinlicher machen würden als die Annahme
einer Stammverwandtschaft des Culmannschen und des Erwinschen
Zweiges.
Aufschlussreich ist auch die Beziehung beider
Hartrad-Linien zur Familie Hohenhaus: Wie oben erwähnt, war schon
der ältere Erwin Hartrad (zum Dorrenbaum) 1346 Zeuge für Else Schwalbächer,
die Frau des Schöffen Gerlach vom Hohenhaus; Else und Gerlach waren
aber auch Besitzer des Hauses Laderam, bevor ihre Erben, die
Geschwister Johann, Hertwig, Gerlach und Rile zum Hohenhaus, es 1357
an Liebel Hartrad aus der Culmann-Linie verkauften. Die Tochter des
Johann zum Hohenhaus wiederum heiratete später den Neffen Erwin
Hartrads d. J., Henne Drutmann (den Sohn von Erwins Schwester
Katharine Hartrad). 1409 ist dann
Erwin d. J. Zeuge auf Seiten des Henne Luneburg, eines Erben des
Hauses Hohenhaus, als dieser einen Ehevertrag schließt (Institut
für Stadtgeschichte Frankfurt, Holzhausen-Urkunden 243). Nun fanden im Mittelalter Immobiliengeschäfte gerne innerhalb der Verwandtschaft statt, und auch für Testate bemühte man bevorzugt Familienangehörige; so spricht einiges dafür, dass zur Familie Hohenhaus von beiden Hartrad-Linien aus verwandtschaftliche Bande bestanden.
Die Hohenhaus schließlich hatten ihrerseits noch andere Kontakte
nach Dieburg: 1343 hatten Gerlach und Else vom Mainzer Erzbischof
für die enorme Summe von 1000 Pfund Heller eine Gülte auf den Mainzischen Anteil am Frankfurter Ungeld und die dem Mainzer Stift zustehende Steuer von Dieburg und
Seligenstadt erworben (bezogen fortan also Einkünfte aus Dieburg;
vgl. Institut für Stadtgeschichte Frankfurt, Privilegien 71); und
bereits 1303, 1304 und 1308 war Hertwig (Hertwin) zum Hohenhaus (der
Vater oder Bruder Gerlachs) Zeuge für Grete, die Witwe des Frankfurter Bürgers Konrad Weiß von Dieburg
(Institut für Stadtgeschichte Frankfurt, Bartholomäusstift, Urkunden und Akten 136 und 140, sowie Hausurkunden 2.083).
Auf die Verschwägerung beider Hartrad-Zweige mit der Familie Frosch
ist bereits hingewiesen worden.
Ein weiteres Indiz ist dem Frankfurter Einwohnerverzeichnis
von 1387 zu entnehmen. Da die Namen hier zumindest teilweise nach
den Wohnorten ihrer Träger geordnet sind, lässt sich anhand der
Liste eine ungefähre Vorstellung von den
Nachbarschaftsverhältnissen in der Stadt gewinnen. Insofern ist es
bemerkenswert, direkt unter dem Eintrag „Erwin
Hartrad“ (d. J.) folgende Namen zu lesen: Conrad Kyme, Henne
Sickenhofen, Richard budeler von Dippurg. Bei allen drei
Personen gibt es einen Bezug zur Dieburger Gegend: bei
Richard Budeler ist er ganz offensichtlich (vielleicht besteht eine
Verwandtschaft zu dem um 1380 in Dieburg geborenen Theologen
Johannes Lagenator von Frankfurt, der 1406, 1416 und 1428/29 Rektor
der Universität Heidelberg war, vgl. Neue Deutsche Biographie; denn
„lagenator“ meint wie „budeler“ den Flaschenmacher); Henne Sickenhofen
wiederum führt seinen Zunamen nach einer Ortschaft nahe Dieburg, in
dem Culmann Hartrad Besitzungen hatte; und den Namen „Kyme“ kennen wir bereits vom Dieburger Kymen-Gut, das Culmanns Bruder
Heilmann gehörte (s.o.). Es ist nicht abwegig, hierin einen Hinweis
darauf zu sehen, dass auch die Familie Erwins Verbindungen in den Dieburger Raum
hatte, die nach dem Umzug ins nahe Frankfurt nicht ganz abgerissen waren. Dieses Bild vervollständigt sich durch einen Währschaftsbrief aus dem Jahr
1419: Henne Hartrad, der Bruder Erwins, verpachtet als Vormund
seiner Nichte Adelheid (Elchin) aus deren Besitz
ein Backhaus in der Frankfurter Fahrgasse für einen Erbzins von
jährlich 2 Gulden und 4 Schillingen an Bechtold Steindecker aus
Münster (Institut für Stadtgeschichte Frankfurt, Hausurkunden 2.542); gemeint ist hier wohl Münster bei Dieburg, wo Friedrich
Hartrad seit 1296 die Mühle Kistelberg (Münstermühle) besaß.

Kleriker
der Diözese Mainz
Da sowohl Dieburg als auch Frankfurt im Mittelalter zur (freilich sehr großen) Mainzer Diözese gehörten, sind in den Umkreis der Frankfurter Hartrad vielleicht noch einige Mainzer Kleriker dieses Namens aus dem 14. und 15. Jahrhundert zu rechnen:
Johann Hartrut, „pastor in gunczenheym“ (= Mainz-Gonsenheim, Kliem, S. 148);
Hermann Hartradi, der im Juli 1363 und im Januar 1369 in Regensburg als Notar zwei kirchliche Urkunden beglaubigt; ein weiterer, mit dem ersten kaum personengleicher
Hermann Hartrad, der 1424 als Priester an St. Peter in Fritzlar bzw. an SS. Maria und Sebastian in Naumburg (bei Fritzlar) nachgewiesen ist; schließlich
Johannes Hartrad, 1429 und 1430 ebenfalls Kleriker an der Fritzlarer Peterskirche.
 
Ansicht von Rauschenberg, Matthäus Merian, 1655

Die Marburger
Hartrad
Eine zweite
bürgerliche, vielleicht patrizische Familie Hartrad gewinnt im
Spätmittelalter in der Marburger Gegend Konturen. Zuerst kommt der
Name hier im Jahr 1325 mit Johann
Hartradi vor: er ist Zeuge, als Konrad von Wahlen und seine Ehefrau
Gertrud dem Kloster Caldern bei Marburg ihre Güter zu Brungershausen
verkaufen. Ein Johann Hartradi begegnet
auch 1318, 1320 und
1331 als Schöffe zu Neustadt (heute Kreis Marburg-Biedenkopf); ob
es sich bei ihm um einen Angehörigen der Familie Hartrad handelt
oder aber um einen Sohn des Neustädter
Schöffen Hartrad von Momberg, ist nicht sicher zu entscheiden.
Öfter findet sich in den Urkunden ein Marburger Bürger Heinz oder Heinrich
Hartrad: 1357 bezeugt er einen Landverkauf in Leidenhofen an
zwei Nonnen des Klosters Hachborn; 1364
urkundet er als Zeuge gemeinsam mit Johann von Biedenkopf, einem Verwandten des
Frankfurter Reichsschultheißen Siegfried
von Biedenkopf, gen. von Marburg zum Paradies; 1375 übergibt er dem Kloster Hachborn zu seinem
Seelgedächtnis einen Acker in Hachborn, den er selbst von seinem
Bruder, dem Marburger Deutschherrn Gottfried Hartrad, gekauft
hat, als er schon verwitwet war; in einer Marburger Urkunde von 1384
wird er als verstorben bezeichnet.
Ein weiterer mutmaßlicher Ast der
Familie sind die Hartrad aus Rauschenberg (heute ebenfalls im Kreis
Marburg-Biedenkopf gelegen). Heinrich
Hartradis von Ruschinberg ist 1355 Bürger zu Kirchhain;
vielleicht derselbe Heinrich Hartrad
amtiert 1371
als Unterschultheiß zu Rauschenberg, wo sein Bruder Hartrad (!)
im selben Jahr Bürgermeister ist. 1428 schlichtet Graf Johann II. von Ziegenhain einen Streit zwischen den Rauschenberger Bürgern
Johann Hartradis und Heinrich Koch, die beide das Erbe eines Dietrich Schnabel für sich beansprucht hatten.
Ein Dietmar Hartrad
aus Rauschenberg („Dyetmarus
Hartrudis de Rausenperg“) immatrikuliert sich im Oktober 1417 an
der Universität Wien.
Aus
Alsfeld schließlich, östlich von Marburg gelegen, stammt Johannes
Hartrad, der in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts ins
Alsfelder Augustinerkloster eintritt und 1447 als Prior des
Augustinerklosters zu Waldheim (bei Meißen) genannt wird. Eine von
ihm stammende, heute in Trier verwahrte Handschrift (Hs SdB 274)
belegt seine wissenschaftlichen Interessen. Mit der Urkunde von 1447
übergibt Prior Johannes den Augustinern zu Alsfeld eine Wiese bei
der Hellmühle an der Eifa (bei Alsfeld), die schon seinen
verstorbenen Eltern gehört hatte und die seine Mutter zu der Zeit,
als er selbst dem Alsfelder Konvent beigetreten war, dem Kloster
versprochen hatte.
Möglicherweise gehören hierher auch: ein Johannes
Harttrut de Homberg, der seit 1446 an der Erfurter Universität
studierte, sofern es sich bei seinem Heimatort um Homberg an der Ohm
(zwischen Marburg und Alsfeld) und nicht um Homberg an der Efze (südlich
von Kassel), Homburg bei Kusel (Rheinland-Pfalz) oder um einen der
Orte Homberg im Westerwald, am Bodensee oder in Nordrhein-Westfalen
handelt; sowie ein Henne Hartradt, der in einer Urkunde von 1476 im nordhessischen
Treysa (bei Schwalmstadt, nördlich von Alsfeld) als ehemaliger Söldner
des hessischen Landgrafen Hermann erscheint. Auch eine Verbindung zu
einigen verstreuten Namensträgern in der Kasseler Gegend wäre
denkbar (mehr).

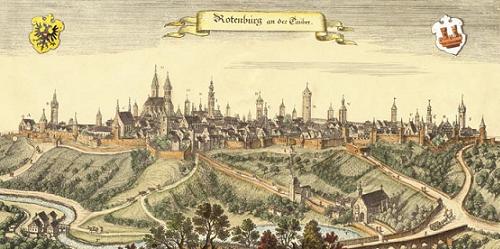
Ansicht von Rothenburg. Kolorierter Stich von Matthäus Merian, 1648
| große
Ansicht

Die Rothenburger Hartrad
Rothenburg
ob der Tauber ist die Heimat einer dritten mittelalterlichen Familie
Hartrad, die hier zu den Ehrbaren,
also den ratsfähigen, patrizischen Geschlechtern gehörte. Eine
Verwandtschaft mit den Hartrad aus Dieburg erscheint weder
ausgeschlossen noch zwingend. Als vorläufige Hinweise auf eine
eventuelle Verbindung mögen die engen Beziehungen der Rothenburger
Hartrad zum Deutschen Orden gelten, die sie mit den Dieburger Hartrad teilen, sowie die Tatsache, dass die Hartrad aus
Rothenburg Lehnsleute der Herren von Hohenlohe waren, in deren
Besitz sich im 14. Jahrhundert zeitweilig die Stadt Dieburg befand.
Das Mainzer Oberstift, zu dem Dieburg seit 1310 ganz gehörte,
reichte bis weit ins Fränkische hinein und zog sich als
zusammenhängendes Territorium von Dieburg über Seligenstadt,
Aschaffenburg, Miltenberg und Amorbach bis Külsheim und
Tauberbischofsheim - alles Städte, die seit 1346 dem
Neunstädtebund angehörten. Auch mag das Wappen der Rothenburger Hartrad, drei im Dreipass
gekreuzte Eichelstäbe, ein Verweis auf den Dreieicher Reichsforst
um Dieburg, Hayn und Münster sein. In jedem Fall ist die räumliche
Mobilität zumindest der bürgerlichen Oberschicht dieser Zeit nicht
zu gering zu veranschlagen.
Die
Rothenburger Familie wird, sofern man einen 1250 in Rothenburg oder
Würzburg genannten Konrad
Hartroet nicht hierherzählt, zuerst 1335 mit Heinz oder Heinrich
Hartrad fassbar. Er wird in Urkunden auch „der Ältere“
genannt, hatte also wohl einen (sonst aber nicht sicher bezeugten) gleichnamigen Sohn oder aber, im Mittelalter durchaus nicht unüblich, einen jüngeren Bruder dieses Namens.
Heinrich
war, gemeinsam mit seiner Frau Agnes, ein besonderer Wohltäter des
Deutschen Ordens, der in Rothenburg die Stadtpfarrkirche zu St.
Jakob verwaltete. 1343 errichtet Agnes dort zu ihrem Seelenheil
einen Jahrtag und übergibt dem Orden dafür 5 Pfund Heller zum Kauf
eines Weingartens bei Detwang. 1346 begründet Heinrich eine tägliche
Frühmesse am Johannesaltar zu St. Jakob nebst Unterhalt für einen
Ordenspriester und schenkt den Deutschherren hierfür die am Weg
nach Detwang gelegene Spitalsmühle sowie 60 Pfund Heller
baren Geldes; zu dieser Messe tätigt Agnes 1356, nach Heinrichs
Tod, noch eine Zustiftung von 30 Pfund Heller. 1348 zahlen die
Eheleute 18 Pfund Heller für ein ewiges Licht in derselben Kirche,
nachdem sie dort zu einem früheren Zeitpunkt bereits ein Ewiglicht
gestiftet hatten. Vielleicht im Gegenzug zu dieser ersten Stiftung
versprechen die Deutschherren den beiden in einer Urkunde von 1339
die Teilhabe an allen guten Werken des Ordens, also Predigten,
Gebeten oder Seelenmessen.
Für
den Deutschen Orden tritt Heinrich Hartrad d. Ä. auch wiederholt
als Zeuge auf. Schon die Urkunde von 1335 hatte einen Landverkauf
des Heinrich Schel zu Bütthard an das Deutsche Haus zu Rothenburg
zum Inhalt. Im Jahr darauf bezeugt Heinrich den Verkauf der
Baumgartenmühle bei Rothenburg an den dortigen
Deutschherrenkonvent; Verkäufer ist das überschuldete
Deutschordenshaus in Archshofen unter dem Komtur Gottfried d. Ä.
von Hohenlohe-Brauneck, dessen Bruder, Gottfried d. J., bis 1310 ein
Viertel der Stadt Dieburg besessen hatte.

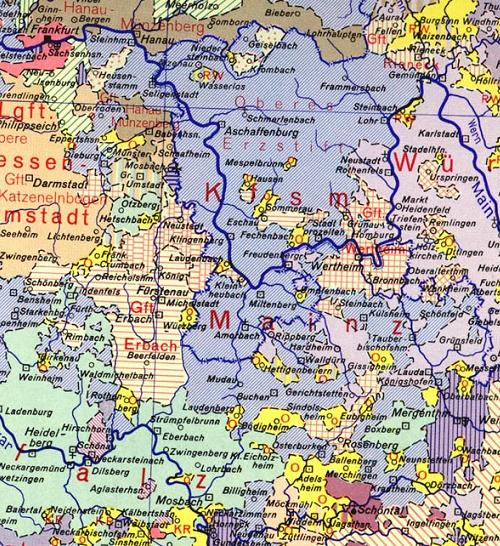
Das Mainzer Oberstift. Oben rechts die Reichsstadt Frankfurt, südlich
Dieburg
Rund um
Rothenburg, vor allem westlich der Stadt, im Hohenloher Land um Kocher, Jagst und Tauber, kauft Heinrich Hartrad in den Jahren zwischen
1336 und 1351 umfangreichen Landbesitz - gemäß dem ungeschriebenen
Gesetz des Rothenburger Patriziats, Grundrenten zu erwerben und sich
nicht an Handwerk und Handel zu beteiligen. So gehen 1336 ein Hof,
Seldenhäuser, Gärten, Äcker, Wiesen und Wald in Storrenhofen
aus dem Besitz der Familie Storre in den Heinrichs über, 1340 dann zwei
weitere Höfe im selben Ort (darunter der sog. Storrenhof);
nach dem neuen Eigentümer erhält der Weiler Storrenhofen den Namen
Hartradshofen (heute Hartershofen). 1341 kauft Heinrich Anteile eines Birkenbühel genannten
Waldes, 1342 eine Gülte von 10 Pfund Heller vom Rothenburger
Johanniterhaus sowie 2 Tagwerk Wiesen in der Mark Stretberg von der
Familie Küchenmeister von Nortenberg, 1343 zwei weitere Seldenhäuser
zu Hartradshofen, 1344 verschiedene Gülten zu Blumweiler, 1345
Holzrechte in Yrfershoven von den Brüdern Haupt, 1349
mehrere Äcker von den Johannitern, 1351 schließlich einige Güter
und Gülten von Konrad und Adelheid von Kurnberg. Interessant ist
ein Landkauf aus dem Jahr 1343: Elisabeth, die Witwe Gottfrieds von
Hohenlohe, veräußert „den wol bescheiden mannen“ Siegfried
Zuckmantel und Heinrich Hartrad, Bürgern zu Rothenburg, für 597½
Pfund Heller ihre Güter in Wermutshausen, Streichental und
Rinderfeld, behält sich aber ein 4jähriges Rückkaufsrecht vor.
Der Bruder Gottfrieds, ebenfalls Gottfried mit Namen, war 1293-1297
Deutschmeister zu Mergentheim, also zu der Zeit, als der Dieburger
Friedrich Hartrad von der dem Mergentheimer Haus unterstellten
Kommende Sachsenhausen die Mühle Kistelberg pachtete; über ihre
Schwester Agnes waren beide Gottfrieds zudem Onkel Ulrichs III. von
Hanau, dessen Schultheiß in Dreieichenhain seit 1353 Culmann Hartrad, der Sohn Friedrichs, war.
Im
Frühjahr 1355 scheint Heinrich gestorben zu sein, da seine Witwe
Agnes im März 1355 zu seinem Gedenken einen Jahrtag am Rothenburger
Johanniterhaus stiftet und am selben Tag um eine Summe von 50 Pfund
Heller für sich und ihre Nachkommen ein Siechenbett im neuen
Rothenburger Spital kauft. 1357 vermacht sie dem Spital mehrere Güter
und Abgaben in Grub, mit der Maßgabe, aus den Einkünften alle 14
Tage den Siechen ein Bad zu bereiten. Agnes wird noch 1359 als Käuferin
dreier Güter zu Tiefental genannt, für die sie den beachtlichen
Betrag von 266½ Pfund Heller bezahlt. In einer Urkunde von 1372
wird sie als verstorben erwähnt.
Ein 1373 als schon verstorben bezeichneter Heinrich Hartrad, von dem die Zuckmantel Güter in Hartershausen übernehmen (Borchardt, S. 295), könnte einer der Söhne Heinrichs d. Ä. sein.
Von
den weiteren Kindern Heinrichs und der Agnes kennen wir sieben: Anna
Hartrad wird 1361
und 1372 als Frau des Edelknechts Konrad Dürr (Durre) genannt, Klara
Hartrad 1356 als Frau des Fritz Bernger zu Lauda. Johann Hartrad ist 1360, 1364 und 1367 Deutschherr zu Rothenburg und
vielleicht personengleich, vielleicht aber auch der gleichnamige
Bruder eines schon 1343 erwähnten Johann
Hartrad. Die Witwe eines Wilhelm
Hartrad, Vele (Felizitas), stiftet im Jahr 1380 für sich und ihren
verstorbenen Mann einen Jahrtag am neuen Spital zu Rothenburg.
Als ein
weiterer Sohn Heinrichs d. Ä. erscheint Sifrid Hartrad mit
wenigstens einem (namentlich nicht bekannten) Kind (Jahrbuch für
fränkische Landesforschung, S. 201). 1352 bestätigt Sifrid gemeinsam mit seinem Vater sowie seinem Bruder Engelhard Hartrad der Gräfin Irmengard von Nassau die Bezahlung einer Summe von
300 Pfund Hellern, die die Gräfin, eine geborene Hohenlohe, der
Familie schuldig war; auch hier ergeben sich vielleicht Beziehungen
nach Hessen, insofern Irmengards Mann Gerlach von Nassau seit 1326
Reichsvogt der Wetterau war und nach dem Erlöschen des Hauses
Merenberg 1328 die Vormundschaft über die Töchter Hartrads VII.
von Merenberg erhielt.
Engelhard
Hartrad wird noch 1364 und 1369 in
Rothenburger Urkunden genannt; im Lehenbuch Gerlachs von Hohenlohe
ist er im März 1357 als hohenlohischen Lehensnehmer verzeichnet:
„Item her Gerlach hat gelihen Engelhart Hartrat den obern hof zu
Hartrades hofen, da Walther Hofmann auf sitzt und auch den zehenden
daz dritteil da selbst zu Hartrades hofen“. Weitere Güter besitzt
Engelhard in Augsteten und
Niederstetten, dazu ein Haus in Rothenburg. Aus der Ehe mit einer
Tochter des Schweinfurter Bürgers Berthold Salzkestner hatte
Engelhard zwei Kinder, Hans und Katharina (Henselin
und Ketherlin), die 1364 ihrem Großvater Berthold in Kost gegeben
werden, bis sie „zu irn tagen koment“, also: volljährig sind
(die Salzkestner waren eine ursprünglich Würzburger
Patrizierfamilie: Endres Salzkestner, im 14. Jahrhundert Bürgermeister
zu Würzburg, und Georg Salzkestner, 1473—1496 Abt des Würzburger
Benediktinerklosters St. Stephan, gehören hierher). Ein Johann
Hartrat, vielleicht der Sohn Engelhards, ist für 1383 in Bütthard
bei Tauberbischofsheim bezeugt (Bayerisches Staatsarchiv Würzburg, Stift Neumünster Würzburg Urkunden 1383 August 24;
als Hanns Hartrat bei Engel Nr. 236). 1362 wird hier auch ein Ritter (?), 1375
ein Edelknecht Hartrad von Bütthard
(Buttert) genannt, bei dem es sich aber vielleicht um ein
Mitglied der Truchsessen von Baldersheim handelt; „Hartrad“
kommt bei dieser Familie mehrfach als Personenname vor, so schon
1284 mit dem Stammvater des Hauses, 1353 mit seinem Urenkel Hartrad
I. und 1395-1412 mit dessen in Bütthard begüterten Sohn Martin,
gen. Hartrad („Mertin Trussetz Hartrach genannt, gesessen zu
Butirt“, vgl. Archiv des Historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg,
Bd. 15, S. 378f. / Stammtafel der Truchsesse von Baldersheim ebd.
Bd. 20, S. 212-215).
1363, 1364 und 1369 findet sich schließlich Konrad
Hartrad, wohl ebenfalls ein Sohn Heinrichs d. Ä., in
Rothenburger Urkunden, und zwar 1364 als Zeuge für Engelhard, 1369
als Bürger des Rats (Ratsherr). Sein Siegel zeigt, abweichend von
dem seines Bruders Engelhard, eine einzelne, aufrecht stehende
Eichel. Um das Jahr 1370 werden Konrad durch das Landgericht
Rothenburg die Nutzrechte an verschiedenen Immobilien zugesprochen,
deren Eigentümer sich vermutlich verschuldet hatten und nun einen
Teil ihrer Besitzungen als Sicherheit herausgeben mussten. Zu den
von Konrad übernommenen Gütern gehörten insbesondere die Vesten
Bemberg (Bebenburg) und Gammesfeld aus dem Besitz des Wilhelm von
Bebenburg. Das Urteil scheint angefochten worden zu sein, da Konrad
im November 1370 den Rothenburger Stadtschreiber als seinen Bevollmächtigten
zu Kaiser Karl IV. nach Prag schickt, um den Schiedsspruch bestätigen
zu lassen. Tatsächlich erlangte Konrad beim kaiserlichen
Hofrichter, dem Landgrafen Johann I. von Leuchtenberg, auch die
Feststellung seiner Rechte; als Schirmer des Urteils wurden unter
anderen der Burggraf zu Nürnberg, die Herren von Hohenlohe sowie
die Städte Würzburg, Rothenburg, Dinkelsbühl, Feuchtwangen und
(Schwäbisch) Hall eingesetzt. Spätestens 1385 wird Konrad gestorben sein, da
seine Tochter Sophia im
April dieses Jahres an der Rothenburger Deutschordenskirche für ihn
und seine (wohl noch lebende) Frau Kathrin einen
Jahrtag mit Vigil, Seelmesse und vier brennenden Kerzen binnen acht Tagen vor oder nach Egidii
stiftet, der mit den Erträgen aus einem Gütlein zu Hachtel dotiert
ist. 1390 errichtet Sophia in derselben Kirche einen Jahrtag für sich
und ihren Mann, den aus ritterbürtiger Familie stammenden Herold
vom Rein (Borchardt, S. 687).
Wohl an diese Patrizierfamilie Hartrad erinnert noch heute der Rothenburger
Herterichbrunnen, der in älterer Zeit Hartratsbrunnen heißt (Bensen 1856, S. 42 / 1841, S. 24). Der unterirdische Kanal, über den das Wasser
für den Brunnen in die Stadt hereingeleitet wurde, war seit 1418 in Bau; er endete auf dem Hauptmarkt direkt vor dem alten Rathaus und den Häusern der Familie Zuckmantel (mit der Heinrich Hartrad
geschäftlich, vielleicht auch privat verbunden war). Heute steht hier die durch Carl Spitzweg bekannt gewordene Marienapotheke, die auch als Weihnachtsmarktnippes und Modelleisenbahnzubehör beliebt ist.


Der Herterichbrunnen (Hartradsbrunnen) in
Rothenburg, dahinter die Marienapotheke (Ausschnitt aus einem
Papierbastelbogen)

Der
Kartäuserprior Michael Hartrad
Keiner
der genannten Familien klar zuzuordnen ist ein im 15. Jahrhundert
mehrfach bezeugter Kartäusermönch Michael Hartrad (Hartrut). Verschiedentlich
wird Augsburg als sein Geburtsort angegeben (Hogg, S. 13, Stöhlker, S.
758),
allerdings stets zusammen mit dem Namen
„Michael Hartritt“ (so auch bei Glauche, S. 253, und Immler, S.
147), was ausweislich der
folgenden Quellen wohl ebenso falsch gelesen ist wie der bisweilen
vorkommende Name „Michael Hartnit“ (vgl. Hogg, S. 186; „Hartrit“
als Nebenform zu
„Hartrat“ finde ich einmal 1425 im Fränkischen mit Hartrit
Truchseß von Baldersheim, der sonst urkundlich Hartrat Truchseß
von Baldersheim heißt, vgl. H. Bauer: Die Truchsesse von Baldersheim. In: Archiv des historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg 15, Würzburg 1860/1861, S. 379;
als Familienname kommt „Hartrit“ in Urbach bei Nordhausen in
Thüringen vor: Maria Hartrit, Tochter des Christoph Hartrit, *1605,
heiratet 1627 Martin Thelemann und stirbt 1679, vgl. Stammtafel der Familie
Thelemann. In: Sippenverband Ziering-Moritz-Alemann, Nr. 5 Mai 1941, S. 202;
da Urbach wenig nordöstlich von Bad Langensalza liegt, könnte es
eine Verbindung zu den dortigen Namensträgern Hartrad [Nägelstedt
1278]
und Hartrot [Schönstedt / Weißensee 1437] geben;
„Hartrit“ wäre auch hier also Variante zu
„Hartrat“).
Wir
begegnen Michael zunächst - wohl noch als Laien - an der
Universität Paris, wo er der
„Natio Anglicanae (Alemaniae)“ angehört, der Landsmannschaft
der englischen, nordeuropäischen und deutschsprachigen Studenten.
1416 erwirbt er hier unter dem Magister Wilhelm Lochem sein
Lizentiat und bezahlt eine Gebühr von 2 Schillingen (Sous):
„Michael Hertruyt [...] cujus bursa II sol[idi]“ (Denifle/Chatelain,
S. 207f.). Dass Michael in Paris studierte, macht eine Herkunft aus
dem Schwäbischen eher unwahrscheinlich; denn im 15. Jahrhundert war
die Pariser Universität bei weitem nicht mehr so international
geprägt wie in den zwei Jahrhunderten zuvor, als Studenten aus ganz
Europa hier zusammentrafen. Besonders die Errichtung neuer
Hochschulen - Prag (1348), Wien (1365), Heidelberg (1385), Köln (1388), Erfurt (1389/92),
Leipzig (1409) - sorgte dafür, dass sich das Pariser Einzugsgebiet
im Heiligen Römischen Reich zunehmend auf die holländischen und
rheinländischen Randgebiete beschränkte. Auf den niederdeutschen
Raum verweisen auch die Namen von Michaels Lehrer und Kommilitonen.
Unter den Mitstudenten kommen Theodericus Ghelren, Theodericus de
Gouda und Nicholaus de
Gouda sicher aus den Niederlanden; und Wilhelm
Lochem (†1448), der
später
Pfarrer zu Deventer und Kanonikus zu Emmerich war (Wilhelm Kohl [Bearb.]: Die Bistümer der Kirchenprovinz Köln. Das Bistum Münster 2. Die Klöster der Augustiner-Chorherren
[= Germania Sacra Neue Folge 5], 1971, S. 178 / Andreas Dederich: Annalen der Stadt Emmerich. Meist nach archivalischen Quellen, Wesel 1867, S.
120), stammte
wohl aus Lochem bei Zütphen und Deventer in Geldern.
1417
ist Michael bereits Magister, scheint aber
nicht in Paris gewesen zu sein, sondern den Erzbischof von Bourges
zum Konzil von Konstanz begleitet zu haben; denn bei der
Landsmannschaft unter Magister Johannes von Zütphen (!) „[...] supplicavit magister Michael Hartrut, quatenus possit inrotulari, si contingat fieri rotulum et inscribi tamquam presens, viso ejus recessu ad Constanciam
cum domino suo domino archiepisopo Bituricensi, cujus supplicacioni natio annuit si et in quantum natio hoc facere
posset“ (Magister Michael Hartrut erbittet, angesichts seiner Rückkehr nach Konstanz mit seinem Herrn, dem Erzbischof von Bourges, sich in die Matrikel gleichsam als anwesend einschreiben zu dürfen; diesem Ersuchen stimmt die Landsmannschaft
[Natio] zu, insofern dies in ihrer Macht steht; vgl. Denifle/Chatelain,
S. 218f.). Das Konstanzer Konzil hatte im November 1414 seine
Beratungen aufgenommen, und in der Tat ist im Jahr 1417 der Erzbischof von Bourges,
Guillaume de Boisratier (1409–1421), unter den Konzilsteilnehmern
(vgl. Louis Moreri: Le grand dictionaire historique ou le Mélange curieux de l`Histoire sacrée et profane (...), Lyon 1681,
S. 620). Auch Michaels Lehrer, Wilhelm Lochem, war - allerdings im
Jahr zuvor - als Verhandlungsführer einer Delegation der Brüder vom gemeinsamen Leben
in Konstanz gewesen (Theo Klausmann: Consuetudo consuetudine vincitur. Die Hausordnungen der Brüder vom gemeinsamen Leben im Bildungs- und Sozialisationsprogramm der Devotio moderna, 2003, S. 111).
Bald darauf scheint Michael dem Kartäuserorden beigetreten zu sein,
denn 1422 finden wir ihn als Novizen in der Großen Kartause, dem
Mutterhaus des Ordens bei Grenoble. Der Theologe und Mystiker
Johannes Gerson berichtet im November dieses Jahres in einem in Lyon
geschriebenen Brief von mehreren Konventsmitgliedern der Kartause,
mit denen er in Kontakt stand, und gedenkt dabei unter anderen des
Oswald de Corda (des späteren Vikars der Großen Kartause) sowie
des „venerabili novicio Michaeli Hartrut“ (Hobbins 2004, S. 171).
Während Gerson und Oswald de Corda, die von April 1424 bis April oder Mai 1429 einen
lebhaften Briefwechsel unterhielten, sich vermutlich nie begegneten
(vgl. Oswalds Biographie im Bibliographisch-Biographischen
Kirchenlexikon), beruht die Korrespondenz zwischen Gerson und
Michael wohl auf einer persönlichen Bekanntschaft. Zum einen hatte
Gerson 1395 das Kanzleramt an der Universität Paris übernommen und
lebte - nach einem Aufenthalt in Flandern - seit 1404 wieder in der
französischen Hauptstadt; andererseits war Gerson, der als Kirchenpolitiker
entschieden den konziliaren Gedanken vertrat, ebenfalls Teilnehmer des Konzils
zu Konstanz, wo er die Verurteilung und Hinrichtung des Jan Hus betrieb und sich den Beinamen eines
Doctor christianissimus erwarb. An beiden Orten könnten
Gerson und Michael zusammengetroffen sein. Der Kontakt zu Gerson (†1429)
bestand noch im Jahr 1426, als Michael den großen
Theologen um Lektüreempfehlungen bittet. Gerson antwortet am 9. Juni 1426 mit einem Brief und dem beigefügten Traktat
De libris legendis a monacho (Über Bücher, die ein Mönch
lesen sollte; vgl. Hobbins 2004, S. 185).
Der weitere Lebensweg führte Michael zu hohen Ämtern innerhalb des
Kartäuserordens (Daten nach Hobbins 2004 und 2009 sowie Hogg, S. 13).
Von der Grande Chartreuse aus kam er 1427 als Prior in die Reichskartause Buxheim bei
Memmingen. Seine wohl hier verfasste Oration De passione domini hat
sich in einer Sammelhandschrift erhalten, die in der Bayerischen Staatsbibliothek München
aufbewahrt ist ( Manuskript Clm 4634, vgl. Glauche, S. 253). Neun
Jahre später, 1436, kehrte Michael nach Frankreich zurück und
wurde Prior des Klosters Sainte-Marie de Portes
in Bénonces, der ältesten Filiale der Großen Kartause. 1439-1455
war er Convisitator und Visitator
der Ordensprovinz Aquitanien. Seine letzten Lebensjahre verbrachte Michael in der Kartause zu Vauclaire, wo er von 1454 bis 1456 als Prior bezeugt ist.
Für
den 14. März 1461 verzeichnen die Akten des Kartäuser-Generalkapitels
den Tod des „Dom[i]nus Michael Hartrut, monachus professus domus
Carthusie, quj fuit alias Prior domus Aule Marie et Portus Beate Marie et Visitator
Prouincie Aquitanie, qui habet per totum Ordinem plenum cum psalteriis
monachatum. Cuius obitus dies scribatur in kalendariis conuentualibus sub xiiija
Marcij“ (Hogg, S. 19).


Sitzung der Gelehrten, Bischöfe, Kardinäle und des Papstes Johannes XXIII. im Konstanzer Münster. Kolorierte Federzeichnung aus der Chronik des Konzils von Konstanz des Ulrich Richental, um 1460/65

Der
Artikel zur Familiengeschichte als PDF-Dokument:


Die Hartrad von Dieburg: Stammtafel 
Familien Hartrad im Mittelalter:
Stammtafel 

Quelle zum Download:
Johann Carl von Fichard genannt Baur von
Eyseneck: Hartrad.
In: Geschlechtergeschichte der Stadt Frankfurt am Main, Ms. um 1810,
fasc. 124, Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt am Main 

Literatur und Quellen (Auswahl):
Dietrich Andernacht/Otto Stamm (Bearb.): Die Bürgerbücher
der Reichsstadt Frankfurt 1311-1400 und das Einwohnerverzeichnis von
1387. Frankfurt am Main 1955
Dietrich Andernacht/Erna Berger (Bearb.):
Die Bürgerbücher der Reichsstadt Frankfurt 1401-1470. Frankfurt am
Main 1978
Dieter Aumann: Über 500 Jahre Familiengeschichte (Ouwamann, Owemannm Awemann, Awmann, Auman, Auman). Im Einfluß des sie begleitenden Zeitgeschehens, ca. 1999
Johann Georg Battonn: Oertliche Beschreibung der Stadt Frankfurt am
Main, hg. vom Verein für Geschichte und Alterthumskunde in
Frankfurt, Band 3. Frankfurt am Main 1864
Ludwig Baur (Bearb.): Hessische Urkunden.
Bd. 1 Starkenburg und Oberhessen 1016-1399, Darmstadt 1860 (Neudruck
Aalen 1979), Nr. 173, 184, 211, 543, 565
Werner Becher/Roman
Fischer: Die Alte Nikolaikirche am Römerberg. Studien zur
Stadt- und Kirchengeschichte (Studien zur Frankfurter Geschichte
32). Frankfurt am Main 1992
Heinrich Wilhelm Bensen: Historische Untersuchungen über die ehemalige Reichstadt Rotenburg: oder Die Geschichte einer deutschen Gemeinde aus urkundlichen Quellen, Nürnberg 1837
Heinrich W. Bensen: Alterthümer, Inschriften und Volkssagen der Stadt Rotenburg ob der Tauber, Ansbach 1841
Heinrich Wilhelm
Bensen: Kurze Beschreibung und Geschichte der Stadt Rotenburg ob der Tauber, Erlangen 1856
Johann Friedrich
Böhmer: Die Baudenkmäler in Frankfurt am Main. Bd. 2,
Frankfurt am Main 1898, S. 138f. und 213f.
Johann Friedrich Böhmer/Friedrich Lau:
Codex diplomaticus mœnofrancofurtanus.
Urkundenbuch der Reichsstadt Frankfurt. Bd. 1, Frankfurt am Main
1901, Nr. 175, 703, 968, und Bd. 2, Frankfurt am Main 1905, Nr. 54, 345
Karl
Borchardt: Die geistlichen Institutionen in der Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber und dem zugehörigen Landgebiet von den Anfängen bis zur
Reformation, 1988
Friedrich Bothe: Geschichte der Stadt
Frankfurt am Main, 1913, erw. 1923 und 1929, Nachdruck Frankfurt 1966
Henricus Denifle / Aemilius Chatelain (Bearb.): Liber Procuratorum Nationis Anglicanae (Alemaniae) in Universitate Parisiensi, Paris 1897, S. 207f. bzw. 218f.
Alexander Dietz: Frankfurter
Handelsgeschichte. Bd. 1, Frankfurt am Main 1910, S. 170, 180,
182
Dagmar Drüll
(Hg.): Heidelberger Gelehrtenlexikon 1386-1651, Band 3, Berlin u.a. 2002
Wilhelm
Engel (Bearb.): Urkundenregesten zur Geschichte der kirchlichen
Verwaltung des Bistums Würzburg im hohen und späten Mittelalter (=Regesta
Herbipolensia II). Würzburg 1954, Nr. 236
Arnold Erler: Das „Cremser Gericht“ zu (Frankfurt-)Eschersheim. Ein Beitrag zur Namensdeutung, in: Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst 59, 1985, S. 103-134
Johann Carl von
Fichard genannt Baur von Eyseneck: Frankfurtisches Archiv für
ältere deutsche Litteratur und Geschichte. Frankfurt am Main 1811
Johann Carl von
Fichard genannt Baur von Eyseneck: Die Entstehung der
Reichsstadt Frankfurt am Main, und der Verhältnisse ihrer Bewohner.
Frankfurt am Main 1819
Eckhart
G. Franz (Bearb.): Kloster Haina. Regesten und Urkunden. Bd. 1,
Marburg 1962, Nr. 824, 852, 853, 858 / Bd. 2/1, Marburg 1970, Nr.
306, 330, 449, 723
Heinz
F. Friederichs: Die Familie Weiß v. Limpurg. Die Familie
Knoblauch (=Forschungen zur hessischen Familien- und Heimatkunde 36,
Frankfurter Patrizier im 12.-14. Jahrhundert H. 2). Frankfurt am
Main 1958
Heinz
F. Friederichs: Johann Fust. Die Cöllner zum Römer
(=Forschungen zur hessischen Familien- und Heimatkunde 57,
Frankfurter Patrizier im 12.-14. Jahrhundert H. 5). Frankfurt am
Main 1969
R. Froning (Bearb.): Frankfurter Chroniken und
annalistische Aufzeichnungen des Mittelalters, Frankfurt am Main
1884 (S. 420: Stammtafel Frosch)
Günter Glauche (Bearb.): Die Pergamenthandschriften aus Benediktbeuern: Clm 4501-4663 (= Katalog der lateinischen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München), Wiesbaden 1994
Stefan Grathoff: Mainzer Erzbischofsburgen. Erwerb und Funktion von Burgherrschaft am Beispiel der Mainzer Erzbischöfe im Hoch- und Spätmittelalter, Stuttgart 2005 (= Diss. Univ. Mainz 1996)
Otto
Grotefend/Felix Rosenfeld (Bearb.): Regesten der Landgrafen von
Hessen. Bd. 1, Marburg 1929, Nr. 772c
Andreas Hansert (Hg:) Aus
Auffrichtiger Lieb Vor Franckfurt. Patriziat im alten Frankfurt,
Frankfurt am Main 2000 (darin v.a. die Einführung des Herausgebers,
S. 13-31
Andreas Hansert / Hans Körner: Frankfurter Patrizier. Historisch-Genealogisches Handbuch der Adeligen Ganerbschaft des Hauses Alten-Limpurg zu Frankfurt am Main (= Deutsches Familienarchiv 143/144), Neustadt an der Aisch 2003 (darin v.a. Andreas Hansert: Zur Geschichte der Adeligen Ganerbschaft des Hauses Alten-Limpurg zu Frankfurt am Main im 19. und 20. Jahrhundert, S. 12-25, insbes. S. 12ff.)
Fritz Herrmann: Die
Einwohner des Mainzischen Amtes Dieburg im Jahre 1540. In:
Mitteilungen der Hessischen Familiengeschichtlichen Vereinigung 2,
S. 17-22
Daniel Hobbins: Editing and Circulating Letters in the Fifteenth Century: Jean Gerson, Uberius quam necesse, 10 November 1422. In: Bulletin de Philosophie Médiévale 46, 2004, S. 169-190
Daniel Hobbins: Authorship and Publicity Before Print: Jean Gerson and the Transformation of Late Medieval Learning, Philadelphia 2009, S. 18
James Hogg (Hg.): Die Reichskartause Buxheim 1402-2002 und der Kartäuserorden. Internationaler Kongress vom 9. bis zum 12. Mai 2002, S. 19
Konstantin Höhlbaum (Hg.): Mittheilungen aus dem Stadtarchiv von Köln, Zwölftes Heft, 1887 (Das Urkunden-Archiv der Stadt Köln seit d. J. 1397. Inventar. I. 1397-1400)
Gerhard Immler
(Bearb.): Staatsarchiv Augsburg, Fürststift Kempten, Lehenhof Urkunden
(Repertorium Nr. 66), 14. Jh. – 18. Jh., 1997
Jahrbuch für fränkische Landesforschung, Band 54, 1994
Johannes
Janssen (Bearb.): Frankfurts Reichscorrespndenz nebst andern
verwandten Aktenstücken von 1376-1519. Bd. 1, Freiburg i. Br. 1863,
Nr. 300, 302
Wilhelm Jost: Der Deutsche Orden im Rhein-Main-Gau. Ein Quellenbuch für Namenforschung. Gießen 1941 (= Gießener Beiträge zur deutschen Philologie 80)
Wolfgang
Kliem: Die spätmittelalterliche Frankfurter Rosenkranzbruderschaft als volkstümliche Form der Gebetsverbrüderung, Frankfurt 1963, S. 148
Georg
Ludwig Kriegk: Frankfurter Bürgerzwiste und Zustände im
Mittelalter. Frankfurt am Main 1862, Kap. 3, 4, 7 und Anm.
4 und 51
Georg
Ludwig Kriegk: Deutsches Bürgerthum im Mittelalter. Nach
urkundlichen Forschungen mit besonderer Beziehung auf Frankfurt a.
M. Frankfurt am Main 1868, S. 484 und 512
Adalbero Kunzelmann: Geschichte der Deutschen Augustiner-Eremiten. Fünfter
Teil, Würzburg 1974, S. 305-308
Matrikeln der
Universitäten Heidelberg und Wien
Mark Mersiowsky: Die Anfänge territorialer Rechnungslegung im deutschen Nordwesten. Spätmittelalterliche Rechnungen, Verwaltungspraxis, Hof und Territorium, Ostfildern
2000
Walther Möller: Die Mühle „Kistelberg" bei Dieburg. In: Katholischer Kirchenkalender der Pfarrei Dieburg für das Jahr 1922, Nachdruck 1988, S. 281-283
Andreas Niedermayer (hg. von Euler): Die Deutsch-Ordens-Commende Frankfurt am Main. Frankfurt am Main 1874, S. 118ff.
Heinrich von Poschinger: Bankwesen und Bankpolitik in Preussen. Nach amtlichen Quellen bearbeitet. Band 1, Berlin 1878
Heinrich Reimer (Bearb.): Hessisches Urkundenbuch. Zweite Abteilung: Urkundenbuch zur Geschichte der Herren von Hanau und der ehemaligen Provinz Hanau. Leipzig 1892, Nr. 687
Ute Rödel: Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451, Band 14, 2004
Michael Rothmann: Die Frankfurter Messen im Mittelalter, Stuttgart 1995
Thomas Schilp (Bearb.): Die Reichsburg Friedberg im Mittelalter. Regesten der Urkunden 1216-1410, Marburg 1987
Joseph Schmid (Bearb.): Die Urkunden-Regesten des Kollegiatstiftes U. L. Frau zur Alten Kapelle in Regensburg. Bd. 1, Regensburg 1911, Nr. 264, 318
Georg Schmidt: Der Deutsche Orden in Dieburg. In: Dieburg. Beiträge zur Geschichte einer Stadt. Dieburg 1977, S. 78ff.
Georg Schmidt: Blätter zur Geschichte der Stadt Dieburg, 1. Reihe, Dieburg 1972 (1968-1972 als Beilage zum Dieburger Anzeiger erschienen, 1972 gesammelt als Buch herausgegeben)
Felicitas Schmieder: Einigkeit und Adelsferne. Überlegungen zu Entstehung und Abgrenzung der Frankfurter städtischen Oberschicht (im Vergleich mit rheinischen Bischofsstädten). In: „... Ihrer Bürger Freiheit". Frankfurt am Main im Mittelalter. Beiträge zur Erinnerung an die Frankfurter Mediävistin Elsbet Orth, Frankfurt am Main 2000, S. 75-88
Felicitas Schmieder: Kirchenstiftung und Trinkstube. Zur (Früh)geschichte des Frankfurter „Patriziats" im 14. Jahrhundert. In: Spurensuche in Sprach- und Geschichtslandschaften. Festschrift für Ernst Erich Metzner, Münster 2003, S. 477-492
Alfred Schnapp, Friedrich Stöhlker, Klaus Kratzsch u. a. (Hg.): Das Buxheimer Chorgestühl. Beiträge zur Bau- und Kunstgeschichte der ehemaligen Reichskartause Buxheim und zur Restaurierung des Chorgestühls (= Arbeitshefte des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 66), München 1994
Ludwig
Schnurrer (Bearb.): Die Urkunden der Reichsstadt Rothenburg
1182-1400. Bd. 1, Neustadt a. d. Aisch 1999, Nr. 15, 534, 537, 538,
585, 596, 601, 624, 637, 643, 645, 660, 665, 671, 732, 741, 816,
841, 873, 874, 963, 964, 981, 1003, 1004, 1030, 1093, 1133, 1159,
1161, 1199, 1211, 1215, 1237, 1349, 1436, 1441, 1474, 1517, 1578,
1770, 1945
F.
Schrod: Zur Geschichte der Deutschordens-Komturei Sachsenhausen
bis zur Mitte des XIV. Jahrhunderts. In: Archiv für Frankfurts
Geschichte und Kunst, Dritte Folge, Bd. 9. Frankfurt am Main 1907,
S. 93-156, S. 107-110
Friedrich Schunder (Bearb.): Die
oberhessischen Klöster. Regesten und Urkunden. Bd. 1, Marburg 1961,
Nr. 61, 126, 150, 892
Jörg Seiler: Der Deutsche Orden in Frankfurt. Gestalt und Funktion einer geistlich-ritterlichen Institution in ihrem reichsöffentlichen Umfeld bis 1809, Marburg 2003
Martina Spies: Beginengemeinschaften
in Frankfurt am Main. Dortmund 1998 (zugl. Diss. Univ. Frankfurt am
Main), S. 73 und 185
Johann Wilhelm Christian Steiner: Altertümer und Geschichte des Bachgaus im alten Maingau,
3. Teil (Geschichte der Stadt Dieburg...), Darmstadt 1829
Friedrich
Stöhlker: Die Kartause Buxheim 1402-1803/12. Neue Reihe. Die Kartäuser von
Buxheim: der Personalschematismus II, 1554-1812, Band 3, Salzburg 1987
Wolf-Heino
Struck: Quellen zur Geschichte der Klöster und Stifte im Gebiet der mittleren Lahn bis zum Ausgang des Mittelalters, Band 1, Selbstverlag der Historischen Kommission für Nassau, 1956
Gustav Toepke
(Bearb.): Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1386 bis 1662. Erster Teil. Von 1386 bis 1553, Heidelberg 1884
Johann Gerhard Christian Thomas (Hg.: Ludwig Heinrich
Euler): Der Oberhof zu Frankfurt am Main und das fränkische Recht in Bezug auf denselben. Frankfurt 1841
Universität Wien
(Hg.): Die Matrikel der Universität Wien. I. Band. 1377-1450, Graz und Köln 1956
Ernst
Vogt: Erzbischof Mathias von Mainz. (1321-1328), Berlin 1905
Helmut Weigel: Die Deutschordenskomturei
Rothenburg o. Tauber im Mittelalter. Leipzig und Erlangen 1921, S.
116 und 127f.
Dieter J. Weiss: Die Geschichte der
Deutschordens-Ballei Franken im Mittelalter. Neustadt a. d. Aisch
1991, S. 237-240
H. Weissbecker: Wappen-Zeichnungen nach
Siegeln aus dem Archive der ehemals freien Reichsstadt Rothenburg ob
der Tauber (Fortsetzung). In: Der Deutsche Herold. Zeitschrift für
Heraldik, Sphragistik und Genealogie. 16. Jg., Nr. 1, Berlin 1885,
S. 5-9 / Nr. 2, Berlin 1885, Beilage
Hermann Weissenborn (Bearb.): Acten der Erfurter Universitaet. I. Theil (darin 3.: Allgemeine Studentenmatrikel, erste Hälfte [1392-1492]), Halle 1881
Julius
Weizsäcker (Bearb.): Deutsche Reichstagsakten. Bd. 3, Dritte
Abtheilung, 1397-1400, München 1877 / Bd. 4, Erste Abtheilung,
1400-1401, Gotha 1882 / Bd. 5, Zweite Abtheilung, 1401-1405, Gotha
1885 / Bd. 6, Dritte Abtheilung, 1406-1410, Gotha 1888
Karl
Weller (Bearb.): Hohenlohisches Urkundenbuch. Bd. 2, Stuttgart 1900,
Nr. 521, 635, 706
Arthur
Wyss (Bearb.): Hessisches Urkundenbuch. Erste Abtheilung:
Urkundenbuch der Deutschordens-Ballei Hessen, Bd. 2, Leipzig 1884,
Nr. 916 / Bd. 2, Leipzig 1899, Nr. 1200
|

