|
Einführung | Patrizier
| Hessen | Pfalz | Amerika
| Weltweit |
Wappen | Kontakt
| 
Einführung
Zusammenfassung
Könnten
Sie das bitte buchstabieren?
Der Familienname
Sonstige
Namensträger
Geographische
Namen
Cum humana memoria
labilis sit et caduca, cautum est, ut ea, que in tempore geruntur,
sub scriptorum apicibus et sigillorum testimoniis firmentur. *
Zusammenfassung
und Übersicht der Familienzweige
Der
Artikel behandelt die Geschichte der Familie Hartard aus der
Wetterau (Hessen), die 1334 in Friedberg, nördlich von Frankfurt am
Main, mit Peter Hartrad erstmals sicher bezeugt ist. Eine Verbindung
zu einem ursprünglich aus Dieburg stammenden Frankfurter
Patriziergeschlecht Hartrad, das von 1254 bis gegen die Mitte des
15. Jahrhunderts urkundlich erscheint, sowie verwandtschaftliche
Beziehungen zu gleichnamigen Familien in Marburg und Rothenburg ob
der Tauber werden diskutiert.
Hessische,
pfälzische und
amerikanische Hartard, Hartart, Hardardt, Hardart, Hartert, Hardert
und Harter
Die
Wetterauer Familie teilt sich in mehrere Linien, die im 16. und 17.
Jahrhundert in den Städten Friedberg, Wölfersheim, Butzbach,
Münzenberg und Petterweil / Okarben, verschiedentlich auch in
Frankfurt, unter den Namen Hartar(d)t, Hartert und Hardert
vorkommen, spätestens am Ende des 17. Jahrhunderts aber sämtlich
ausgestorben sind. Die heute lebenden Nachkommen der wetterauischen
Hartrat scheinen sich zwei Ästen zuordnen zu lassen, deren
Stammväter beide um das Jahr 1500 geboren sind:
- Der Taunus-Ast
beginnt mit Johann Hartart, der 1543 gräflich nassauischer
Schultheiß in Eschbach (bei Usingen) ist, und seinem Sohn, dem
gräflich wiedischen Rat Hartmann Hartart. Auf Johann
gehen wohl die zwei Hauptlinien der Familie zurück:
Die Hartart in Wernborn, die dort noch heute ansässig
sind, mit einem auf Nikolaus Hartart zurückgehenden
Seitenzweig, dessen Mitglieder seit 1712 in der Pfalz unter
den Namen Hartard (in Freimersheim, Kirrweiler und
Harthausen) und Hardardt (in Sondernheim) vorkommen.
Zahlreiche Nachkommen dieser Linie leben heute auch in den
USA; die amerikanische Speziallinie Hardart ist ein
Abzweig der Hardardt in Sondernheim.
Die Hartert in Griedelbach, die mit dem 1604 genannten
Bernhard Hartert beginnen und sich in zwei Zweige spalten: die
noch blühenden Hartert in Wetzlar und die
Papiermüllerfamilie Hardert in Brandoberndorf
(später in Oberstedten), die 1933 mit Karl Heinrich
Hardert im Taunus ausstirbt, in den USA jedoch bis heute
Nachkommen hat.
- Der Nassauer
Ast beginnt mit dem 1568 gestorbenen gräflich nassauischen
Schultheißen Friedrich Hartart zu Ewersbach (bei Dillenburg)
und seinen Söhnen Wilhelm und Hartmann. Die Familie besteht
noch heute unter dem Namen Hartert und besitzt in den Harter
zu Dauborn vermutlich eine Nebenlinie.
Lothringisch-luxemburgische
Hartard, Harter und Hartert sowie Hartard in Chile, England,
Südafrika und Australien
Neben
diesen hessisch-stämmigen Familien stehen noch unverbunden die
Namensträger aus Luxemburg und dem deutschsprachigen Teil
Lothringens, die dort erstmals zu Beginn des 16. Jahrhunderts mit
dem aus Trier stammenden Benediktinerabt Johannes Hartard erscheinen
und spätestens 1611 auch in der Gegend von Diedenhofen (Thionville)
belegt sind. Auf diese Familien lassen sich wohl zurückführen:
- Die noch
blühenden Hartert
im Großherzogtum Luxemburg sowie westlich in der belgischen
Provinz Luxemburg und östlich in der Trierer Gegend, mit mehreren Seitenlinien in den USA.
- Der
Lothringer Zweig, der mit Pierre Hartard
(*um 1625, †1677) in Varize (an der
Deutschen Nied, östlich von Metz) beginnt und über seine
Söhne in zahlreichen Linien bis heute fortgesetzt wird:
der Linie Hartard in Varize, die auf Pierres Sohn Philippe
zurückgeht,der ersten Linie Harter in Tetingen, die von Pierres Sohn Jean François
abstammt,
der zweiten Linie Harter in Tetingen, die Pierres
Sohn Simon zum Stammvater hat,
der Linie des Charles Hartard
(*um 1650), wohl eines weiteren Sohnes Pierres, die in
Niederfillen (Basse-Vigneulles) beginnt und über acht
Söhne in mehreren Linien weiterläuft, nämlich den Harter
in Bibisch (Bibiche), Schemerich (Chémery) und Freisdorf (Freistroff),
die von Charles` Sohn Dominique abstammen und wohl noch
bestehen, sowie den Hartard in Günglingen
(Guinglange) und Niederfillen (Basse-Vigneulles), die sich von
Charles` Söhnen Claude, Nicolas, Jean, Mathias, Mangin,
Jacques und François herleiten und z.T. bis in
die Gegenwart fortgesetzt werden. Vielleicht aus dieser Linie
(oder von den Hartard in Varize) stammen die Speziallinie in
England (gegründet von Leonard Hartard aus Paris, †1893
in London) und die in Chile (die 1897 mit der Auswanderung des
Émile Hartard Marichal aus Metz beginnt); die Familien in
Südafrika und Australien dürfen wohl zu den englischen
Hartard gestellt werden.
Eine
graphische Übersicht der verschiedenen Zweige gibt es als PDF.


König
Hardald Hardråde von Norwegen fällt 1066
in der Schlacht bei Stamford Bridge gegen den englischen König
Harald Godwinson. Englische Buchmalerei aus dem 13. Jh. (Cambridge University Library, Ee.3.59,
fo. 32v)

Könnten Sie das bitte
buchstabieren?
Durchaus
keine seltene Frage bei einem seltenen, vielleicht sogar seltsamen
Namen. Ein Mensch des Mittelalters hätte dieses Problem nicht
gehabt. Vorausgesetzt, er war des Schreibens überhaupt mächtig, hätte
er den Namen einfach dem Hörensagen nach zu Papier gebracht (und
weil man das tatsächlich noch lange so gehalten hat, heißt die
Familie heute nicht nur Hartard, sondern auch Hardardt, Hardart,
Hartart, Hartert oder Hardert). Zumindest aber hätte der
mittelalterliche Schreiber den Ursprung des Namens schnell erraten
und gewusst, dass es sich eigentlich um einen Vornamen handelt, der
aus zwei Wörtern zusammengesetzt ist: nämlich hart, was im
alten Sinne soviel wie ‚kühn, stark‘ bedeutet, und rat,
was den Ratschlag oder den Ratgeber bezeichnet. Ähnlich wie
‚Konrad‘ meint ‚Hartrad‘ also einen kühnen, einen starken
Ratgeber. Bis ins 15. Jahrhundert hinein schrieb man deshalb
‚Hartrad‘ oder ‚Hartrat‘ (sogar ‚Hartrot‘ und ‚Hartrut‘),
ab dem 16. Jahrhundert zunehmend ‚Hartard‘ oder ‚Hartart‘.
In derselben Zeit setzte auch die Verschleifung des Namens ein, die
‚Hartard‘ zu ‚Hartert‘, ‚Hardert‘ oder ‚Harter‘
werden ließ.
Als Personennamen
findet man ‚Hartrad‘ mindestens seit dem 7. Jahrhundert. Ein thüringischer
Graf Hardrad etwa empörte sich 785 gegen Karl den Großen und wurde
nach der Niederschlagung des Aufstandes 786 hingerichtet. Im
heutigen Frankreich begegnet ‚Ardrad‘
im 9. Jahrhundert als Name eines Vizegrafen von Tours (†898) und
eines Bischofs von Chalon (Bischof ca. 890-920). Auch dem norwegischen König Harald III. (*1015, †1066), der als Gründer Oslos gilt, wurde der Name beigelegt. In die Geschichte ist er als Harald Hardråde, der Strenge, eingegangen; er fiel 1066 bei dem Versuch, den englischen Thron zu erobern, in der Schlacht von Stamford Bridge. Ob der
isländische Vor- und Familienname Harðard etymologisch
ebenfalls hierhergehört, weiß ich nicht.
Im
Mittelalter ist der Name vor allem im
südhessischen Raum verbreitet, nicht zuletzt wohl durch das hier
einflussreiche Geschlecht der Herren und Grafen von Merenberg: bei
ihnen ist ‚Hartrad‘ über
zehn Generationen hinweg Leitname, vom Stammvater Hartrad I.
(um 1090) bis zum Letzten des Hauses, Hartrad VII.; auch der
1031 und 1051 genannte Hartrad, Bruder des heiligen Mainzer
Erzbischofs Bardo, gehört vielleicht hierher. Bis zum 18. Jahrhundert
ist ‚Hartrad‘ oder ‚Hartard‘ dann ein nicht eben häufiger, aber vor
allem in Südwestdeutschland durchaus nicht ungewöhnlicher
Taufname. Während der Regierungszeit des Mainzer Erzbischofs Damian
Hartard von der Leyen (†1678) und seines Bruders, des Trierer
Erzbischofs Karl Kaspar von der Leyen (†1676), war er in beiden
Hochstiften sogar einigermaßen beliebt, ebenso später im Bistum
Speyer während der Regentschaft des Fürstbischofs Heinrich Hartard
von Rollingen (†1719). Heute ist er allerdings bis auf wenige
Ausnahmen (wie den hessischen Architekten Hans Hartrad Meyer-Seipp,
*1924, †2009) ganz verschwunden.

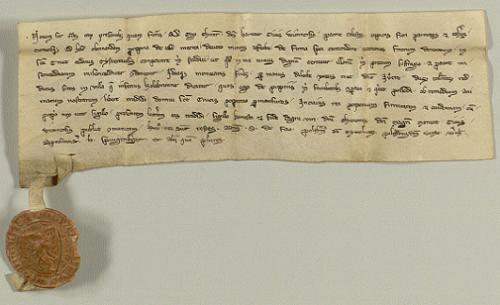
Wien,
1260: Konrad Hartrat vermacht der Abtei Heiligenkreuz Gülten zu Nieder-Hollabrunn.
Sein Name erscheint in der Mitte der ersten Zeile: „Chunr(adus)
d(i)c(tu)s Hartrat“ (Deutschordenszentralarchiv Wien; Quelle:
monasterium.net. Das virtuelle Urkundenarchiv Europas)
Urkunde
von 1260 in großer Ansicht | Urkunde
von 1271 in großer Ansicht

Der
Familienname
Als
Familienname ist ‚Hartard‘ natürlich jünger. Im Bürgertum
kamen erbliche Zunamen erst ab dem 12. Jahrhundert auf, als in den
bevölkerungsreichen Städten an den großen Flussläufen und
Kaufmannsstraßen – etwa in Wien, in Regensburg, in Basel, Straßburg,
Speyer, Mainz, Frankfurt oder Köln – die bloßen Rufnamen nicht
mehr für die sichere Unterscheidung der Bewohner genügten. Zunächst
behalf man sich mit Beinamen, die aber lediglich der näheren
Bezeichnung einzelner Personen, nicht ganzer Familien dienten und
daher kaum ihren Träger überlebten. Sie nahmen Bezug auf dessen
Herkunft, Beruf oder Wohnstätte, auf äußere Kennzeichen oder
Wesensmerkmale, auf den Namen des Vaters oder, seltener, den der
Mutter. Sicherlich entscheidend befördert durch die Eintragung
solcher Namen in offizielle Urkunden wie Bürgerbücher oder
Steuerlisten wandelten sie sich allmählich zu den erblichen
Benennungen der Geschlechter, wie sie im deutschen Sprachraum seit
dem 13. bis 14. Jahrhundert gebräuchlich werden.
Bei
einem im 13. Jahrhundert in Wien bezeugten Konrad Hartrat etwa zeigt sich,
dass der Prozess der Namensbildung
damals noch nicht ganz abgeschlossen war: als Konrad um das Jahr
1260 mit seiner Frau Jutta der Abtei Heiligenkreuz zwei Pfund jährlicher
Gülten zu Nieder-Hollabrunn vermacht, urkundet er als „Chunr(adus)
d(i)c(tu)s Hartrat“ (Konrad, genannt Hartrat); ebenso 1271, als
er, mittlerweile Witwer, dem Kloster Lilienfeld einen Hof in „Imzeinsdorf“
(Inzersdorf) und eine Wiese in Erlaa übergibt (zwei Besitzungen,
die wenig später von seinen Verwandten Kunigunde und Konrad von
Heiligenstadt erfolglos vom Lilienfelder Konvent zurückgefordert
werden).
Ähnliches ist der Fall bei dem im Jahr 1296
erwähnten Leipziger Ratsherrn Heinricus
Hartradi: hier verrät der Genitiv noch die Herkunft vom
Vatersnamen. 1318 indes finden wir denselben Heinrich als „Henricus
Hardrat“ in den Urkunden. Ab dem 14. Jahrhundert erscheint der Name nun durchweg in dieser verfestigten Form, so in Brüx (tschech. Most, in Böhmen) mit
Heinrich Hartrat (1302 und 1306, vgl. Urkundenbuch, Ansicht
der Urkunden hier
und hier) und Johann Hartrat
(1315; vgl.
Schlesinger, S. 22, und Bahlow unter „Hartrath“), in Reichenbach a. d. Lausitz (westlich
von Görlitz) 1356 mit Nyckil Hartrut (Tzschoppe/Stenzel Nr.
CLXIX) oder mit den zahlreichen Namensträgern aus dem oberhessischen Raum (Frankfurt, Wetterau, Dreieich, Taunus), auf die im folgenden näher eingegangen wird.

Sonstige
Namensträger
Zunächst
sei aber noch auf verschiedene Namensträger verwiesen, bei denen
sich kaum eine Verbindung mit unserer Familie herstellen lässt. Mit großer Sicherheit
gilt dies für
die eben genannten Hartrad in Leipzig, Görlitz, Wien und Brüx. Es wäre
spekulativ, sie in die Geschichte der oberhessischen Hartrad /
Hartart einbeziehen zu wollen, wenngleich solche familiären
Verbindungen aufgrund der weitreichenden Wirtschaftsbeziehungen
zwischen den mittelalterlichen Städten Deutschlands natürlich
nicht grundsätzlich auszuschließen sind. So waren etwa die
wichtigen Messeplätze Frankfurt und Leipzig durch drei große
Handelswege miteinander verbunden: die Hohe Straße sowie die Straßen
„durch die langen“ und „durch die kurzen Hessen“; die
meisten hessischen Orte, an denen unsere Familie im Mittelalter und
in der frühen Neuzeit ansässig ist, liegen mehr oder weniger an
einer dieser Routen (so Friedberg, Butzbach, Grünberg, Altenstadt,
Alsfeld, Rauschenberg). Auf halbem Weg zwischen Hessen und Leipzig,
im thüringischen Nägelstedt (bei Bad Langensalza, nahe Erfurt),
erscheint auch schon 1278 ein Heinrich
Hartradi als Zeuge einer Urkunde des Deutschen Ordens; ob ein
Zusammenhang mit einem Heinrich Hartradis in Dieburg bei Frankfurt (mehr) oder
dem gleichnamigen Leipziger Ratsherrn besteht, sei dahingestellt –
sehr plausibel ist es freilich nicht.
Ein 1437 in Schönstedt bei Weißensee, etwas östlich von Bad
Langensalza, genannter Hans Hartrot gehört vielleicht noch
hierher (Küther, S. 203).
Nicht
undenkbar, aber aufgrund der Distanz zum Frankfurter Raum eher
unwahrscheinlich ist auch eine Verbindung zu den Hartrad im nördlichen
Hessen: zwischen 1298 und 1300 findet man in Volkmarsen (nordwestlich von
Kassel) den Ratsherrn (und Bürgermeister?) Konrad Hartradi
sowie im Jahr 1325 seine Witwe Gertrud; nicht weit voneinander südöstlich von Kassel erscheinen Kunne
Hartrades (†1432 in Wickenrode) und Hans Hartrodt (1479
Ratmann zu Eschwege). Vielleicht gehört hierher auch ein Wigand
Hartard, der 1592 als Schüler am Marburger Paedagogium genannt
wird, da er offenbar aus Oberdens, einem Ort nahe Eschwege,
gebürtig ist (mehr).
Eine Verbindung zu den Marburger (sowie den Alsfelder und
Rauschenberger) Hartrad (mehr)
wäre ebenfalls möglich.
Dass nicht bei allen Namensträgern der Vorname ‚Hartrad‘ zugrundeliegt und daher die Herkunft des Namens für jeden Einzelfall gesondert geprüft werden muss, zeigt sich an den schlesischen Hartert, die im 16. Jahrhundert als ‚Hartart‘ oder ‚Hartard‘ urkundlich in Erscheinung treten: so
Balthasar Hartert / Hartardt (Liegnitz 1560), Kaspar Hartard (1557 stud. Wittenberg, später Lehrer in Goldberg / Schlesien und Bürgermeister in Haynau) oder
David Hartard (Pastor in Seebnitz bei Lüben, *26.4.1630, 1650 in Leipzig, ordiniert für Großrinnersdorf 25.4.1660, nach Seebnitz berufen 1665, †1684, Sohn des Goldschmiedes
Georg Hartart, vgl. Klose S. 465); hierher vermutlich auch der protestantische Erfurter Ratsherr
Thamian Hartart (vgl. Meisner S. 128). Ihren Namen jedoch haben diese Personen wohl von den schlesischen Orten ‚Hartha‘ bzw. ‚Hartau‘ erhalten, indem ‚Harter‘ oder ‚Harder‘ sich zu ‚Hartert‘ und ‚Hartart‘ entwickelte: „–er, –ert wechselte in der Schreibweise des 16. Jhs. gern mit –art infolge der Unsicherheit, die durch den Lautwandel –art: –ert: –er bzw. –er: –ert in Personennamen entstanden war“ (Bahlow, S. 139). Möglich wäre auch, dass ‚Harder‘, die schlesische Bezeichnung für den Schäfer, hineinspielt. In anderen Fällen mag ‚Hartert‘ wiederum ‚der am Wald oder an der Weidetrift Wohnende‘ meinen, mit auslautendem ‚-t‘ von älter: ‚Harter‘; in bezug auf die Weinbeere schließlich bedeutete ‚hartrot(h)‘ einst soviel wie ‚rot und hartschalig‘.
Vermutlich
jüdischen Ursprungs (und ausweislich seines Wappens – drei
goldenen Judenhüten im blauen Feld – vielleicht eines Stammes mit
der Familie von Jüdden) ist das kölnische Patriziergeschlecht Hardenrath.
Sein Stammvater Johann Hardenrath (†vor 1479) war im 15.
Jahrhundert aus Hameln an der Weser nach Köln gezogen; durch
Tuchhandel und Kreditgeschäfte reich geworden, stiftete er im Jahr
1466 zusammen mit seiner Frau Sybilla Schlößgin die Salvators-
oder Hardenrathskapelle in der Kirche St. Maria im Kapitol. Von
seinen Nachkommen war Johann d. Ä. Hardenrath (†1602)
Kanzler des Herzogtums Jülich, dessen Bruder Johann d. J.
Hardenrath (†1630) seit 1584 insgesamt 16mal Bürgermeister
von Köln.
Nicht ersichtlich ist die Herkunft eines
Philipp Hartruth, seit 1600 (protestantischer?) Diakon zu Donauwörth, der im Dezember 1607 vor den anrückenden Truppen des bayerischen Herzogs Maximilian I. nach Coburg floh (Burger et al., S. 75 und 302). Im Jahrbuch der Stadt Coburg für 1608 heißt es über ihn: „1608, am heil. Dreikönigstag kam hier der aus Donauwörth vertriebene Diakonus M. Philipp Hartruth an. Es wurden für ihn an der Kirchthür 15 fl. 12 gr. 7 Pfg. eingesammelt, dazu Ein Ehrbarer Rath noch 2 fl.
beisteuerte“ (Karche, S. 382).
Von
dem Taufnamen ‚Hartard‘ oder ‚Hartrat(h)‘ abgeleitet sind möglicherweise
auch die Namen der noch bestehenden Familien Hartrath
(im Raum Wiesbaden / Mainz / Trier: so etwa der Weingutbesitzer Medard
Hartrath, bis 1922 Vorsitzender der Trierer Zentrumspartei und
1912-1918 Abgeordneter des Deutschen Reichstags),
Harterath, Hardrat,
Hardraht und
Hardrath sowie Namen wie Hartroth
(im Rheinland), Hartrodt
(Thüringen) oder (von)
Hartrott; sie können aber ebenso zur Gruppe der Herkunftsnamen
gehören, Familiennamen also, die ihre Wurzel in Orts- und
Flurbezeichnungen haben: ‚hart‘ bedeutet ‚Wald‘‚ und -rott‘/
‚-rodt‘/ ‚-rode‘ sind in Hessen und Thüringen häufige,
auf eine Rodungssiedlung hinweisende Endungen von Ortsnamen. Für
die nordhessischen Namensträger käme als Ursprung etwa Hartenrod
westlich von Marburg in Frage, für die rheinischen Familien die –
heute untergegangene – Ortschaft Hartrath.
Nach dem Ort Hardert (älter:
Hartenrode) im Westerwald
wiederum benennt sich im Spätmittelalter ein niederadliges
Geschlecht, das 1553 mit Johann von Hardert ausstirbt.
Hierher gehören wohl auch Johann von Hardert (von Hartart) und
seine Frau Elisabeth, die um 1450 in einem Anniversar des Klosters
Marienstatt im Westerwald erscheinen. Auch bei dem 1294 urkundlich genannten, in Coveren (=Kobern)
begüterten Ritter Guillaume de Hartert muss angenommen
werden, dass der Name Hartert sich auf eine Besitzung bezieht,
vielleicht das Dorf Hardert
auf der rechten Rheinseite, das wie Kobern in der Nähe von Koblenz
liegt. Ähnliches ist für den 1335 erwähnten Koblenzer Schöffengerichtsschreiber
Johann Hardert zu vermuten, da er auch unter dem Namen de
Hartrode vorkommt.
Ein Godart van der Hartart, Mitte des 14. Jahrhunderts Geistlicher zu Afferden (in den heutigen
Niederlanden, vgl. Kraus S. 272), ist vielleicht mit dem
ehemaligen Schloss Hartelstein bei Itteren, nördlich
von Maastricht im niederländischen Limburg, in Verbindung zu
bringen, da dieses auch
unter der Bezeichnung Hartard oder Hartert vorkommt;
gleiches gilt für Heinrich von der Hartart, der 1393 in die Dienste der Stadt Köln
tritt (Eckertz/Ennen S. 196), möglicherweise auch für eine 1538 zu Tondorf
(bei Nettersheim in der Nordeifel) als Frau des Dietrich Hack von
Lissingen genannte Elisabeth von der Hartart (Schannat S.
233).

Geographische
Namen
Umgekehrt
existieren Ortsnamen, die ihrerseits von dem Personen- oder Familiennamen
‚Hartrad‘ herstammen: so das oberösterreichische Harterding,
nahe dem Inn; Hardradinchus (nach dem sich 1249 ein
Dortmunder Bürger nennt: Wessel von Asseln gen. de Hardradinchus); Hartershausen
bei Fulda (891:
Hartrateshus, später Harteratishusen,
Harttarshusen); Hardradessen, Name zweier nordhessischer Wüstungen
(im Kreis Waldeck bzw. im Kreis Wolfhagen), Harreshausen,
heute ein Ortsteil von Babenhausen, beim hessischen Dieburg (12.
Jh.: Hardirshusen, 1320: Hareshusen), Hartradisbusz, ein
Flurstück bei Frankfurt-Bockenheim (1301). Die Eifelburg Hartelstein
(älter: Hartradstein) bei Prüm, heute Ruine, die 1341 unter
luxemburgische Lehenshoheit fällt, führt ihren Namen nach dem
Erbauer, Hartrad von Schönecken aus dem Hause der Grafen von
Vianden; eine Bastion der Festung
Mainz aus dem 17. Jh. erhielt den Namen Hartard nach dem
Mainzer Erzbischof Damian Hartard von der Leyen. Der Ort Hartershofen
nördlich von Rothenburg ob der Tauber, der ursprünglich nach
seiner Besitzerfamilie ‚Storrenhofen‘
genannt wurde, wechselte zur Mitte des 14.
Jahrhunderts seinen
Namen zu ‚Hartradshofen‘,
als er in das Eigentum des Rothenburger Patriziers Heinrich Hartrad
überging.
* ‚Weil
die menschliche Erinnerung schwach ist und vergänglich, ist es
ratsam, die Dinge, die geschehen, schriftlich und besiegelt
festzuhalten.‘
So lautet der Beginn einer Urkunde, mit der im Jahr 1296 Friedrich
Hartrad von Dieburg und seine Frau Lukard von den
Deutschordensrittern zu Frankfurt-Sachsenhausen die Mühle
Kistelberg erwerben. Vgl. Böhmer/Lau, S. 347

Der
Artikel zur Familiengeschichte als PDF-Dokument:


Literatur und Quellen (Auswahl):
Hans Bahlow: Deutsches Namenslexikon. Familien- und Vornamen
nach Ursprung und Sinn erklärt. Neustadt a. d. Aisch 1972
Helene Burger et. al.: Pfarrerbuch Bayerisch-Schwaben (ehemalige Territorien Grafschaft Oettingen, Reichsstädte Augsburg, Donauwörth, Kaufbeuren, Kempten, Lindau, Memmingen, Nördlingen und Pfarreien der Reichsritterschaft in Schwaben), 2001
Gottfried Eckertz / Leonard Ennen: Quellen zur Geschichte der Stadt Köln, Köln 1879, Bd. 6
Ernst Wilhelm Förstemann: Altdeutsches Namenbuch. Bd. 1,
1900 (Nachdruck München/Hildesheim 1966)
Jacob Grimm/Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch. Leipzig
1854-1960
Philipp Carl Gotthard Karche: Jahrbücher der Herzoglich Sächs. Residenzstadt und des Herzogthums Coburg, Band 3, Coburg 1853
Konrad Klose: Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Verlag Kühn
Lüben, 1924
Thomas Kraus (Bearb.): Regesten der Reichsstadt Aachen (einschließlich des Aachener Reiches und der Reichsabtei Burtscheid), Dritter Band: 1351-1365, (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, XLVII), Düsseldorf 1999
Waldemar Küther
(Bearb.): Urkundenbuch des Klosters Frauensee 1202 - 1540 (= Mitteldeutsche Forschungen 20), Köln und Graz 1961
Joachim
Meisner: Nachreformatorische katholische Frömmigkeitsformen in Erfurt, St.-Benno-Verlag, Leipzig 1971
Carl-Friedrich von Posern-Klett/Joseph Förstemann
(Bearb.):
Urkundenbuch der Stadt Leipzig. Bd. 1, Leipzig 1868, Nr. 21/Bd. 2,
Leipzig 1870, Nr. 36
Johann Friedrich Schannat: Eiflia illustrata oder geographische und historische Beschreibung der Eifel. A. d. Lateinischen von Georg
Bärsch, Bd. 2/1, Leipzig und Aachen 1829
Ludwig Schlesinger
(Hg.): Stadtbuch von Brüx bis zum Jahre 1526, 1876
Gustav Adolf Tzschoppe / Gustav Adolf Stenzel
(Bearb.): Urkundensammlung zur Geschichte des Ursprungs der Städte und der Einführung und Verbreitung Deutscher Kolonisten und Rechte in Schlesien und der Ober-Lausitz, Hamburg 1832
Johann Nepomuk Weis (Bearb.): Urkunden des
Cistercienser-Stiftes Heiligenkreuz im Wiener Walde. Wien 1856, S.
148f.
Gerhard Winner (Bearb.): Die Urkunden des
Zisterzienserstiftes Lilienfeld 1111-1892 (= Fontes Rerum
Austriacarum II/81). Wien 1974, S. 64, 82
|

